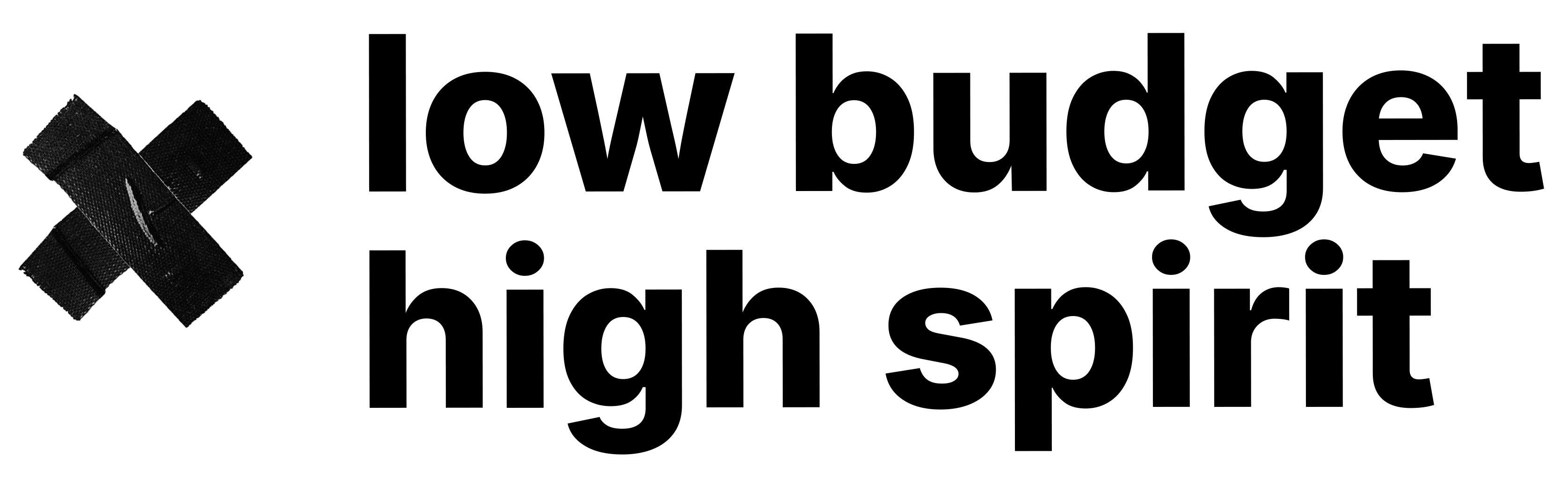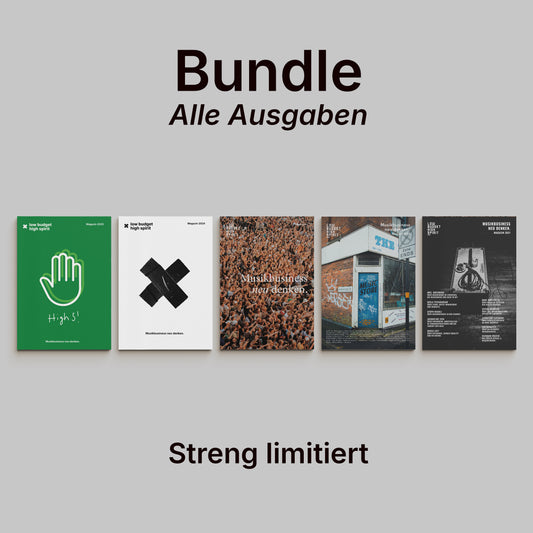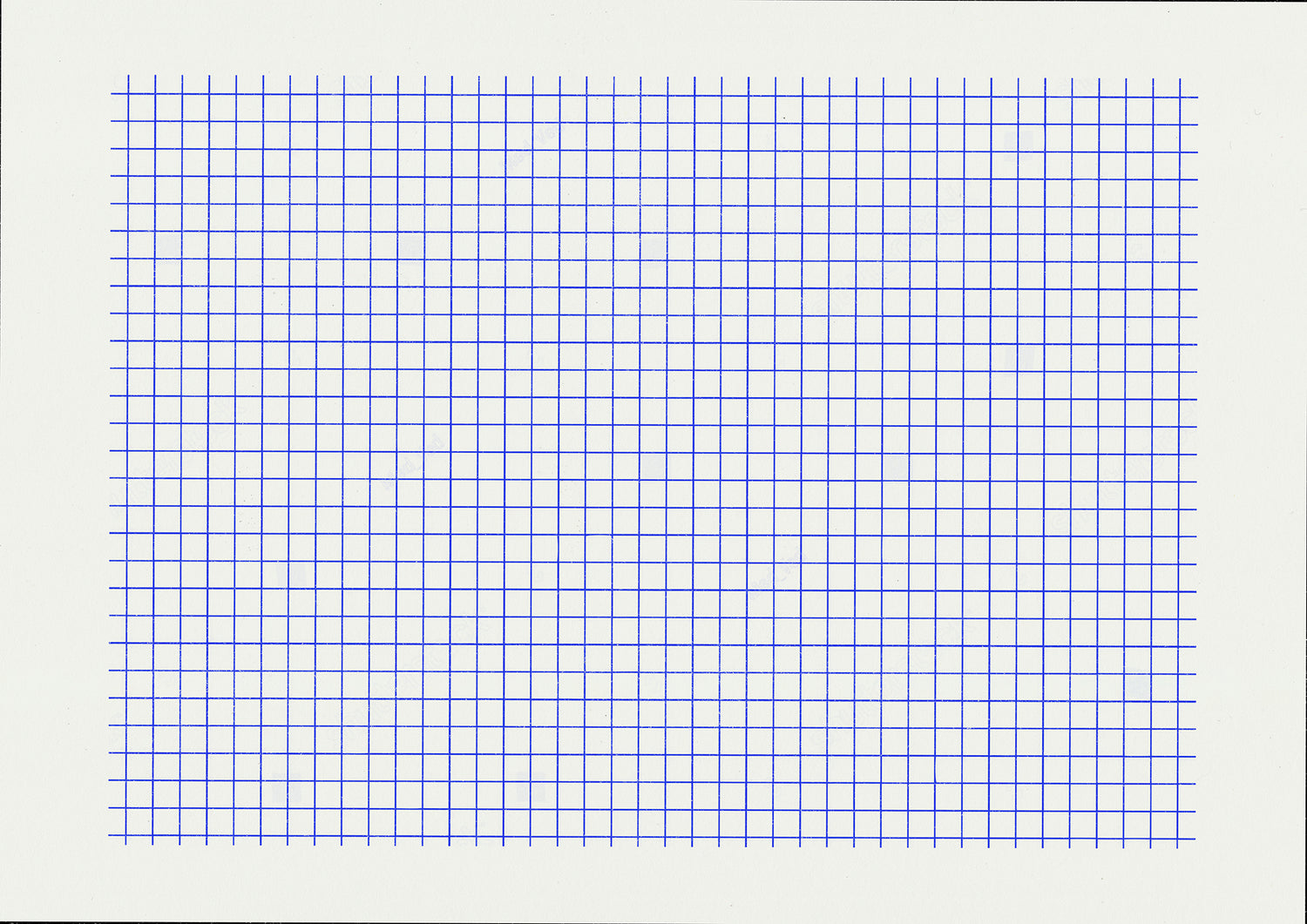Von Torwächtern und Paragleitern

Hannes Tschürtz
Hannes Tschürtz ist Gründer des renommierten österreichischen Indie-Labels und Verlags Ink Music, Co-Gründer des Ticketing Anbieters NTRY und engagierter Speaker und Nachdenker über unabhängiges Musikbusiness. Als Österreicher hat er ein Herzensthema: für die besonderen Gegebenheiten des kleinen Marktes zu sensibilisieren, die Strukturen vor Ort zu stärken und Austria auf die internationale Landkarte zu bringen. Für Low Budget High Spirit schreibt er über die Schwierigkeiten, aus Österreich heraus Traktion in einer Streaming-Ökonomie zu entwickeln und darüber, wie sehr Spotify und Co. innerhalb von 10 Jahren die Metriken für kleine Labels und Artists verschoben haben.
Mehr zu Hannes, seinen Playlisten mit Musik aus Österreich und seinen vielfältigen Aktivitäten unter www.hannestschuertz.com
Mehr zu Ink Music unter www.inkmusic.at
Die IFPI – der international organisierte Verband der Tonträgerindustrie – hat unlängst stolz seine Zahlen des letzten Kalenderjahres präsentiert, in denen sich dicke Zuwächse, in vielen Ländern zweistellig im Plus, abbilden. Das Plus ist fast ausschließlich dem Streaming-Boom zu verdanken – für die Großindustrie sind die Zeiten fraglos besser als noch vor zehn, fünfzehn Jahren. Das oberflächliche Wachstum ist allerdings trügerisch: Immer noch holt man nur schrittweise auf, was in der ersten Phase der Digitalisierung spektakulär an Umsätzen weggebrochen war. Der mitteleuropäische Markt befindet sich wertmäßig auf dem Stand der frühen 90er-Jahre.
Trotzdem sind die beeindruckenden Zahlen ein Zeichen, wie gut es (zumindest und fast ausschließlich) den großen Playern der Industrie heute geht. Mehr als zwei Drittel der Umsätze entstehen aus sogenannter Katalogware. Die Hit-Dichte samt meist wohlwollenden Verträgen zugunsten der Labels zahlt den Riesen zur Zeit leicht und locker Miete, Rente und Dividende. Vorteile, die kleinere Labels oder junge Künstler:innen gar nicht haben können. Schon gar nicht, wenn sie dazu noch aus einem kleinen Land kommen.
Wohl war es nie leichter, seine Musik so schnell und unkompliziert der ganzen Welt zu präsentieren. Aber die Gatekeeper sind deshalb noch lange nicht verschwunden – sie sitzen nur woanders. Musik 2022 an die User*innen zu bringen, bedeutet auch: eine zigfach vervielfachte und globalisierte Konkurrenz durch abertausende Uploads täglich, ein sich immer weiter fragmentierendes Geschäft mit immer kleineren Einheiten; und immer neue Baustellen und Tools, die es zu sehen, zu verstehen und einzusetzen gilt, um mitzuhalten.
Österreichische Musik etwa hat es so immer schwerer, sich im global-digitalen Wettbewerb zu behaupten. Selbst als mittelgroßer Markt (Österreich mit gerade einmal 9 Millionen Einwohner*innen zählt immer noch zu den 25 größten Musikmärkten der Welt) stehen den lokalen Musikschaffenden keine eigenen Büros oder Editorial Teams bei Spotify, Amazon, Apple oder Deezer gegenüber. Kraft Größe ist der „Heimatmarkt“ letztlich Deutschland, die tatsächliche, geographische Heimat ist ein unbedeutender Nebenschauplatz. Und warum? Wenig überraschend zählen in den Zentralen von Technologiekonzernen kulturelle oder gesellschaftliche Werteinheiten bedeutend weniger als die puren, absoluten Zahlen.
Immerhin kann man sich dank ihnen heute – theoretisch – leicht der ganzen Welt präsentieren. Praktisch sind hierzulande schon zehn- bis fünfzigtausend organische Streams für einen Song nicht wenig. Ohne kontextuales Wissen klingen tausende Ohren, die sich in aller Welt deine Musik anhören, auch gar nicht so übel. Doch die Währung im Streaming ist eine völlig andere als in der alten Welt des „Musikbesitzens“: Rund 30 bis 150 Euro bleiben als ökonomisches Resultat aus diesen zehn- bis fünfzigtausend Streams.
Kritisiert man nun deshalb die vieldiskutierte geringen Auszahlungsraten der Streamingdienste, schießt man jedoch am Ziel vorbei und führt eine Scheindebatte. Denn in einer entsprechenden (und durchaus möglichen) Skalierung sind die Zahlen durchaus beeindruckend. Österreichs erfolgreichster Streamer ist der junge DJ Lum!x, den zwar kaum jemand kennt, der aber dank seiner Ausrichtung im EDM-/Dance-Bereich und cleveren Kollaborationen über 10 Millionen Hörer monatlich erreicht. Das ist sogar deutlich mehr als beispielsweise Rammstein und macht zehntausende Euro pro Monat Umsatz für sein (übrigens niederländisches) Label. 2022 vertrat er Österreich beim Song Contest.
Das zeigt uns einen anderen Aspekt des neuen Zeitalters: Im Streaming sind Erfolg und Popularität keineswegs kongruent. Playlisten und Algorithmen bestimmen die Hörgewohnheiten. Wie genau sie funktionieren ist so geheim wie die Originalrezeptur von Coca Cola.
Wo also sitzen die Gatekeeper nun heute? Nun: Heute sitzen sie am Berg und wachen über gute Absprungstellen. Denn Streaming ist ein bisschen wie Paragleiten. Gute Thermik sorgt dafür, dass man durchaus lange mit guter Fernsicht dahin gleiten, im besten Falle sogar noch weiter nach oben kommen kann. Mit wenig Thermik profitiert man im besten Fall noch von guten Gleitfähigkeiten von hohen Startpunkten. Aber von einem kleinen Hügel aus nutzt einem auch guter Aufwind nur mäßig.
Beschäftigt man sich eingehend mit Daten und Beobachtungen aus Tools wie Spotify for Artists und dergleichen, kann man ein paar – letztlich logisch erscheinende – Weisheiten daraus ableiten. Etwa diese: Eine starke organische Nachfrage nach Titeln macht auch kluge Algorithmen aufmerksam. Vorschläge in anderer Leute „Mix der Woche“, in den Release Radars und Hörerradios sind das Salz in der Suppe der heutigen Musikvermarktung. Eine hohe Akzeptanz in diesen Vorschlagsrädern erhöht die Streuung noch weiter – manchmal kontinuierlich und schrittweise sogar global.
Zu beobachten ist das bis hinauf in den Charts, wo Titel heute ungleich länger verbleiben als früher. Der Grund ist simpel: Die heutige Währung – Hörkonsum – ist ein völlig anderer als die von früher – Kaufkonsum – und streckt sich viel länger. The Weeknds „Blinding Lights“ erschien 2019 und ist immer noch in den Hitlisten vertreten. Daneben sorgen mitunter überschwappende Effekte aus sozialen Medien wie TikTok für eine immer weiter gestreckte Multiplizierung, eine Verlangsamung und gleichzeitige Intensivierung des „Viralgehens“: Auroras Titel „Runaway“ aus 2015 wurde mit einem originellen Filter versehen und mehr als fünf Jahre nach seinem Entstehen zum Hit und seither Dauerbrenner.
Fazit: Erreicht man eine gewisse „Flughöhe“, kann man auch gut und lange dahingleiten – und über diesen Weg auch gut und lange Umsätze generieren. Das Geld kommt recht beständig, wenngleich relativ langsam. Und das muss man sich leisten können.
Ein kleines Label aus einem kleinen Land steht so mit jedem neuen Release vor einem potentiellen Teufelskreis: Auch gute organische Zahlen sind oft zu wenig, um den heiligen Algorithmus zu knacken. Selbst eine starke, lokale Fanbase lässt den Artist oft bloß im eigenen Topf verkochen. Ohne hebelnde Editorials oder bedingungsloser internationaler Ausrichtung bleibt der Absprungpunkt ein viel zu niedriger, um nachhaltig Effekte auf algorithmische Playlisten, Langlebigkeit des Produktes und damit letztlich Einkommen zu haben.
Diese erste und wichtigste Hürde ist für viele auch gleich die Letzte. Denn um sie zu schaffen, benötigt es neben einem hochwertigen Produkt – wie immer – Zeit und Geld. Das Label oder der Service-Dienstleister, der es ersetzt, braucht ein exzellentes Netzwerk, eine klare Vorstellung, welche denglifzierten Begriffe zwischen Content Creation, Organic Growth Rate und Classic AdSpending ihm am sinnvollsten und effizientesten erscheinen.
Nur woher nimmt man die tiefen Taschen, um sich das alles leisten zu können, wenn doch der „Return on Investment“ so lange auf sich warten lässt und mit hohen Risiken behaftet ist? Und so bleibt oft alles irgendwie doch beim Alten: Geld macht Geld um des Geldes Willen. Kunst macht Kunst um der Kunst Willen. Für die Allermeisten ist das in jeder Hinsicht wohl unbefriedigend.
Nur treibt all das bereits seit Jahren auf offener Bühne bunte Blüten: Wir hören von Fake Artists, die es nur wegen der guten Streambarkeit auf Playlisten gibt; nehmen die Verkürzung des Pop-Songs auf Tiktok-Länge achselzuckend zur Kenntnis und diskutieren, ob das Album denn jetzt tatsächlich tot sei. Aber war da nicht noch mehr?
An die Existenzfähigkeit und Überlebenschance der „Kleinen“ sind letztlich die Fundamente unserer demokratischen Gesellschaft gekoppelt. Es geht ebenso um Chancengleichheit wie um kulturelle Vielfalt; es geht um die Freiheit der Kunst und um die Kritikfähigkeit eines demokratischen Systems. Das mag zunächst großspurig klingen, aber auch börsennotierte Technologiekonzerne werden begreifen müssen, dass Musik dann doch etwas mehr ist als Malen nach Zahlen; mehr als Mathematik und Algorithmen. Die von ihnen begonnene Revolution wird nicht an einer Umverteilungsdebatte vorbei kommen. Und wir müssen sie führen.
Musikbusiness neu denken. Diesen und viele weitere Texte findest du in den Low Budget High Spirit Magazinen.
-
Das Magazin - Ausgabe 2025
Normaler Preis €10,00 EURNormaler PreisGrundpreis pro -
Das Magazin - Ausgabe 2024
Normaler Preis €10,00 EURNormaler PreisGrundpreis pro -
Das Magazin - Bundle 2025 & 2024
Normaler Preis €17,00 EURNormaler PreisGrundpreis pro -
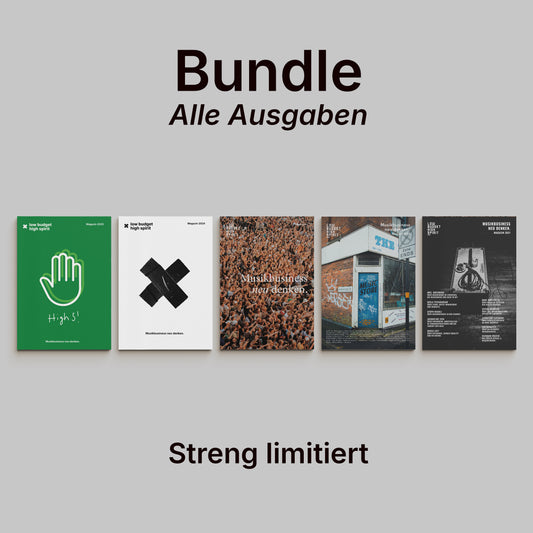 Ausverkauft
AusverkauftDas Magazin - Bundle Alle Ausgaben
Normaler Preis €35,00 EURNormaler PreisGrundpreis pro