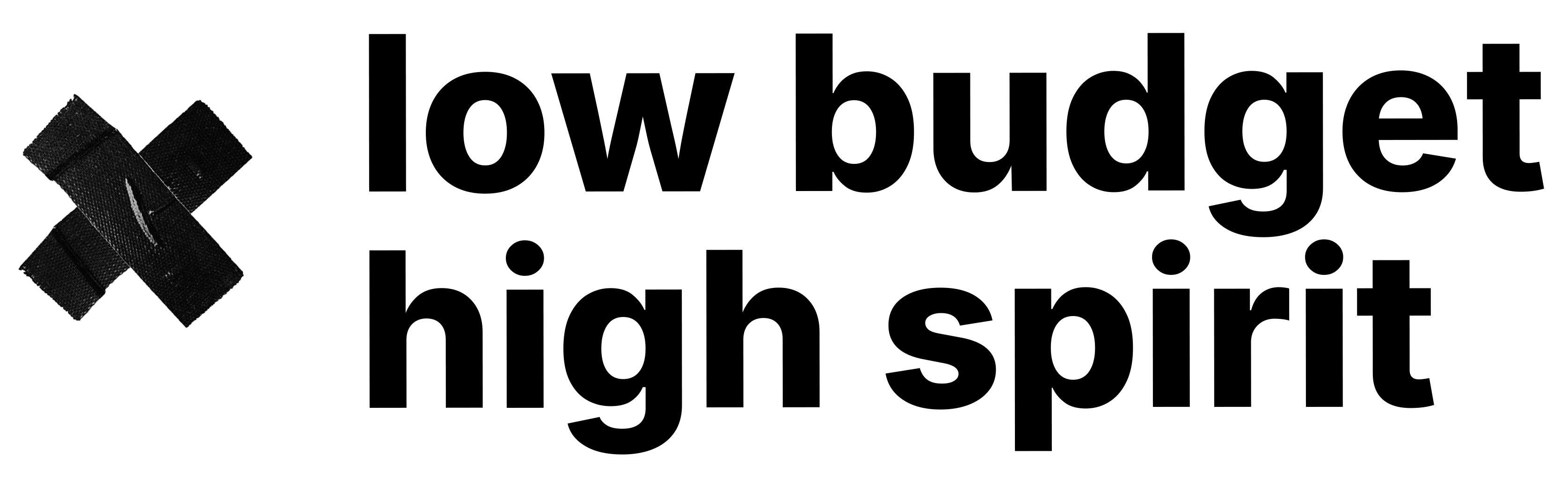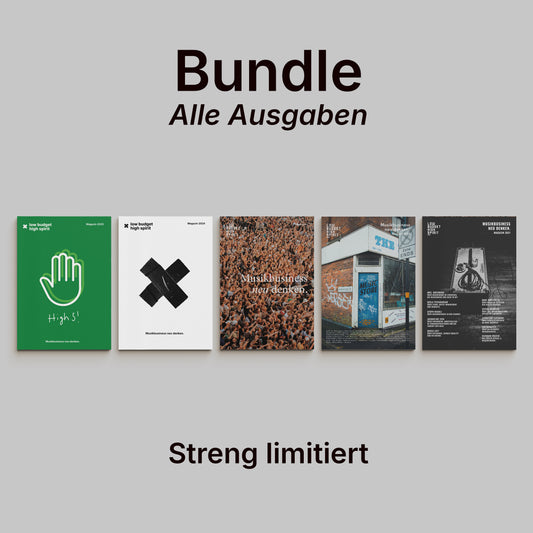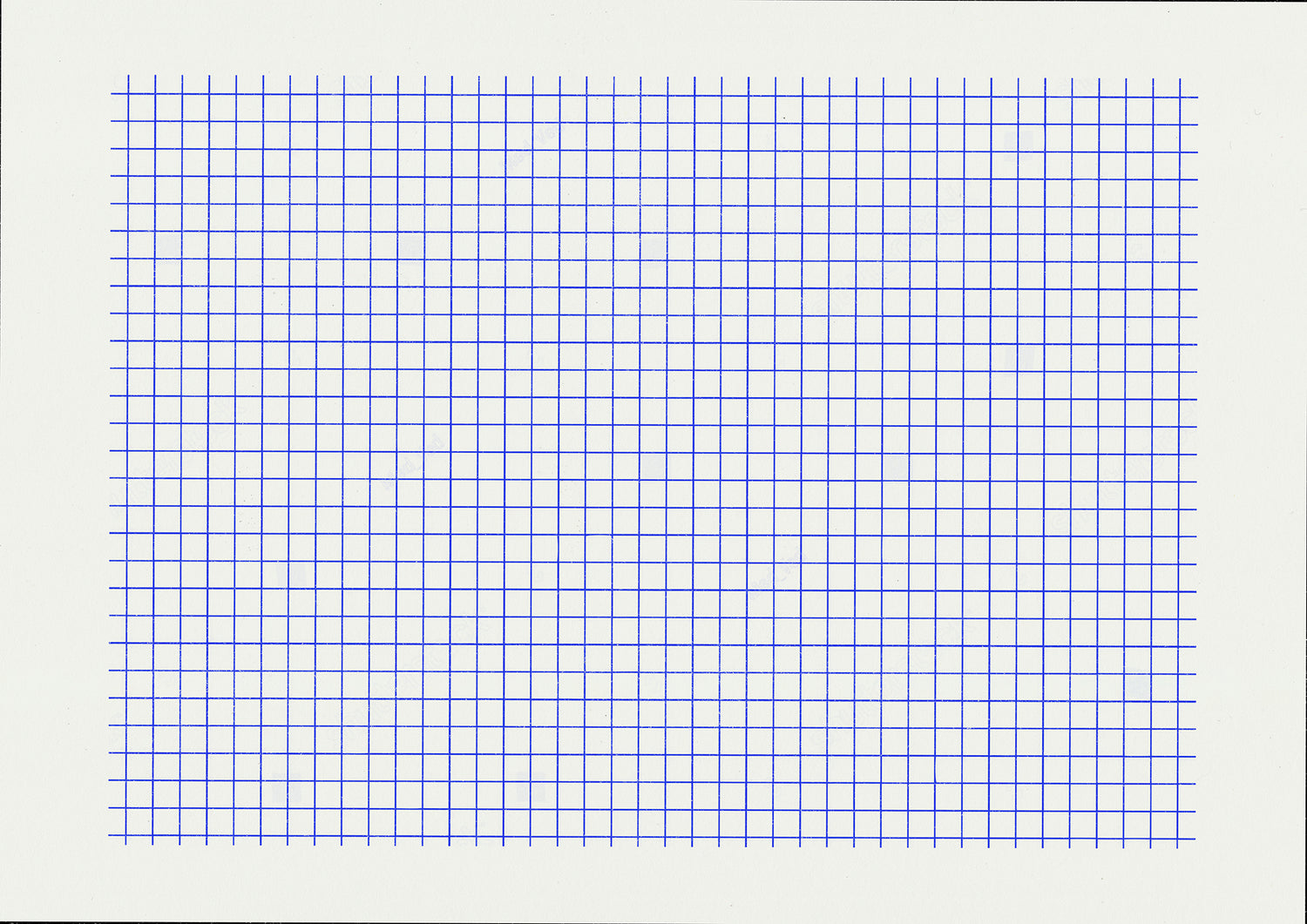Denn wovon lebt der Mensch?

Berthold Seliger
Berthold Seliger ist Konzertagent, Tourneeveranstalter und Publizist, wohnhaft in Berlin. Via seinem «Büro für Musik, Texte & Strategien» bucht er seit 36 Jahren Tourneen für Bonnie ‹Prince› Billy, Patti Smith, Tortoise, Rufus Wainwright und viele andere renommierte Musiker*innen und Bands. Seliger schreibt regelmäßig Artikel zu musik- und kulturpolitischen Themen in deutschen Tageszeitungen und Magazinen. Mit «Das Geschäft mit der Musik» und «Das Imperiengeschäft» hat er zwei der relevantesten deutschsprachigen Bücher über Musikwirtschaft geschrieben. Für Low Budget High Spirit betrachtet Berthold Seliger die soziale Situation von Musiker*innen und wirbt lautstark für konkrete Lösungsansätze und ein Umdenken in der Kulturförderung.
Mehr zu Berthold Seliger via www.bseliger.de
Alle Fußnoten und Anmerkungen finden sich gebündelt am Ende des Textes.
«Denn wovon lebt der Mensch?», lassen Bertolt Brecht und Kurt Weill im zündenden Refrain des 2. Dreigroschen-Finales ihrer Dreigroschenoper Macheath alias Mackie Messer, den Gangsterboss mit guten Beziehungen zum Polizeichef, und Frau Peachum, Ehefrau des Kopfes der Bettler-Mafia, fragen: «Wie ihr es immer schiebt und dreht, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Erst muss es möglich sein, auch armen Leuten vom großen Brotlaib sich ihr Teil zu schneiden.»
Doch wovon leben die Musiker:innen heute? Welchen Teil vom großen Brotlaib können sie sich abschneiden? Und gibt es im Musikbusiness unserer Tage etwa auch Gangster, Bettler oder gar eine Mafia? Viel zu oft beginnen Features zum Thema mit der These, dass Musiker:innen heute gezwungen seien, vermehrt Konzerte zu spielen, weil mit Tonträgern im Zeitalter des Musikstreamings ja kein Geld mehr zu verdienen sei. Pro-Tipp: Wenn Sie diesen Quatsch irgendwo lesen oder hören, sparen Sie sich das Weiterlesen oder Zuhören, denn die Journalist:innen, die diesen Unsinn verbreiten, dürften auch von allem anderen wenig Ahnung haben. Mal abgesehen davon, dass es für die meisten Musiker:innen nicht eine aus finanzieller Not geborene, ungeliebte Verpflichtung, sondern vor allem ein Vergnügen darstellen dürfte, die eigene Musik vor Fans darbieten zu können, denn darauf kam es ja schon immer an: Musik einem Publikum zu präsentieren! Mal abgesehen davon, stimmt diese These halt einfach nicht. Das Geld wurde in der Popkultur immer schon «live» verdient, auf Konzerten, bei Tourneen. Während andersherum die Plattenfirmen schon immer alles getan haben, um die Musiker:innen möglichst schlecht zu bezahlen und ihnen einen möglichst geringen Anteil an den Einnahmen aus Schallplatten- oder CD-Veröffentlichungen zukommen zu lassen. Wie sagte der legendäre britische Radio-DJ John Peel: «Die großen Plattenfirmen haben nie so getan, als seien sie zu etwas anderem da, als möglichst viel Geld zu verdienen, von dem sie den Musikern möglichst wenig abgeben.»
Oder rufen wir als Zeugen einen Musiker an, dessen Band nicht nur zig Millionen Alben, sondern auch Abermillionen Konzerttickets verkauft hat, und der darüber hinaus als gewiefter Geschäftsmann gilt: «Mit Platten ließ sich nur eine sehr, sehr kurze Zeit lang Geld machen, aber jetzt ist diese Periode vorbei», stellte ein gewisser Mick Jagger zu Beginn der 2010er-Jahre in einem BBC-Interview fest. Und mit dieser «sehr, sehr kurzen» Periode meinte er die Phase, in der die Tonträgerindustrie im Geld schwamm, weil es ihr gelungen war, den Fans das Billigprodukt CD als besonders anspruchsvolles Musik-Tool schmackhaft zu machen. So gelang es den Plattenfirmen, den Fans die gesamten Backkataloge, die sie schon als Vinyl zuhause stehen hatten, nochmal zu drastisch überhöhten Preisen anzudrehen. Und dank den Riesengewinnen warf die Musikindustrie dann knapp zehn Jahre lang auch mit Geld um sich. Da wurden Bands mit relativ hohen Vorschüssen unter Vertrag genommen, die vor und nach dieser Boomphase wohl kaum einen Plattenvertrag mit der Industrie bekommen hätten, und wenn, dann höchstens für einen Appel und ein Ei. (Und am Rande: All die Vorschüsse waren «recoupable», wie der Abrechnungsmodus heißt, mit dem die Musikindustrie die Musiker:innen faktisch zu einer Art moderner Sklaven macht; kein Zufall, dass Musiker:innen wie Prince oder Michelle Shocked sich auf den Anti-Sklaverei-Artikel der US-amerikanischen Verfassung beriefen, als sie sich mühsam von den Daumenschrauben-Verträgen ihrer Plattenkonzerne freiklagten). Und seinerzeit wurden Journalist:innen nach New York oder nach Mallorca zu Release-Partys geflogen und in Luxushotels untergebracht, damit sie «angemessen» unkritisch über die Produkte «berichteten», also Jubelarien verfassten.
Wollen wir diese Zeiten wirklich zurückhaben? Doch wohl kaum.
Lassen wir die Zahlen sprechen – zur aktuellen sozialen Lage von Musiker:innen in Deutschland
Die jährlichen Erhebungen der Künstlersozialkasse (KSK) dürften der verlässlichste Indikator sein, wenn man mehr über die Lebensbedingungen selbständiger (also der Mehrheit aller) Musiker:innen erfahren will, denn bei der KSK sind alle selbständigen Künstler:innen und Publizist:innen mit einem jährlichen Mindesteinkommen von 3.900 Euro renten- und von 7.070 Euro auch krankenversichert. Das Durchschnittseinkommen der aktiv Versicherten bei der KSK im Bereich Musik beträgt aktuell (zum 01.01.2024) 16.569 Euro (1.381 Euro monatlich), mit einem signifikanten Gender-Gap: Männer kommen auf 18.466, Frauen nur auf 13.745 Euro (und anders als bei den Männern, wo ein geringfügiger Anstieg zu verzeichnen ist, stagnieren die Einkommenszahlen der Frauen seit Längerem auf geringem Niveau).(1)
Zum Vergleich: Mit dem aktuellen gesetzlichen Mindestlohn von 12,41 Euro, der ja auch nur bei gerade einmal 53 Prozent des Medianlohns aller Vollzeitbeschäftigten liegt, kämen Musiker:innen bei angenommenen 40 Wochenarbeitsstunden auf ein Jahreseinkommen von 25.812 Euro (brutto). (2) Das Durchschnittseinkommen selbständiger Musiker:innen liegt also mehr als ein Drittel (genau: 35,8 Prozent) unter dem gesetzlichen Mindestlohn, und das der Musikerinnen beträgt sogar gerade einmal etwas mehr als die Hälfte (53 Prozent) des Mindestlohns. Hält man sich vor Augen, dass in der KSK auch gutverdienende Musiker:innen versichert sind, die den Durchschnitt anheben, wird klar, dass die soziale Realität für viele selbständige Musiker:innen hierzulande wirklich düster aussieht.
Im April 2023 hat das Deutsche Musikinformationszentrum (MIZ) die Ergebnisse einer «Repräsentativbefragung zu Erwerbstätigkeit, wirtschaftlicher Lage und Ausbildungswegen von Berufsmusizierenden» veröffentlicht. (3) Mal abgesehen davon, dass eine Untersuchung, die nur etwa 600 der in Deutschland vermuteten 150.000 bis 180.000 «Berufsmuszierenden» (also «alle Personen, die ihren Lebensunterhalt ganz oder überwiegend mit Musik bestreiten oder zumindest regelmäßig Einkünfte aus musikalischen Tätigkeiten erzielen») befragt hat, möglicherweise nicht ganz so repräsentativ sein könnte, wie behauptet – aber einige interessante Erkenntnisse können aus der Veröffentlichung doch gezogen werden. Etwa, dass die deutliche Mehrheit (nämlich 70 Prozent) der Berufsmusizierenden zusätzlich zu ihrer musikalisch-künstlerischen Tätigkeit noch musikpädagogischen oder nicht-musikalischen Tätigkeiten nachgeht – die Studie spricht elegant von «beruflichen Mosaiken». Dabei spielt die musikpädagogische Tätigkeit vor allem für sozialversicherungspflichtige Angestellte eine größere Rolle («besonders häufig Frauen und ältere Berufsmusizierende im Alter von über 60 Jahren») und wird von diesen gerne «aus Leidenschaft» ausgeübt – während das Drittel aller professionellen Musiker:innen, das auch eine Tätigkeit ausübt, die nichts mit Musik zu tun hat, «dies überwiegend aus finanziellen Gründen» tut, einfach, weil sie ohne diese Tätigkeit finanziell nicht über die Runden kämen oder ohne Alterssicherung dastehen würden. Das Problem, dass immer mehr Menschen nur mit mehreren Jobs ihr Leben finanziert bekommen, betrifft natürlich beileibe nicht nur Musiker:innen, sondern laut Dienstleistungsgewerkschaft ver.di mehr als 3,5 Millionen Menschen in Deutschland – mit steigender Tendenz. Die bittere Realität einer Klassengesellschaft.
Interessant sind die (wenigen) soziologischen Erkenntnisse der Untersuchung: Hier wird bewiesen, dass das Elternhaus prägend für die Berufsbiografien ist; 56 Prozent der Berufsmusizierenden haben Eltern, die selbst Musik gemacht haben. Vor allem aber zeigt sich, dass der Weg zur beruflichen Musikausübung kaum ohne die finanzielle Unterstützung der Eltern möglich ist: Zwei Drittel der Berufsmuszierenden wurden in der Ausbildung von ihren Eltern unterstützt, und mehr als die Hälfte erklärt sogar ausdrücklich, «dass es ohne die finanzielle Unterstützung der Eltern nicht möglich gewesen wäre, Berufsmusiker:in zu werden». Und «jeder Vierte hat auf dem Weg zur Berufsmusik ausschließlich Privatunterricht genommen», konnte sich also diese kostspielige Ausbildungsform leisten.
Eine große soziologische Studie zu Herkunft und Schichtzugehörigkeit der Protagonisten der deutschen Musikszene (also nicht nur der Musiker:innen, sondern auch der Kulturarbeiter:innen, Managements, Angestellten von Plattenfirmen etc.) steht leider immer noch aus. Es lässt sich aber festhalten, dass die meisten Musiker:innen mindestens aus der besserverdienenden Mittelschicht, zum Teil auch explizit aus der Oberschicht stammen, also aus der Klasse derjenigen, die über ausreichende Mittel verfügen, ihren Kindern die Ausbildung zu professionellen Musiker:innen zu ermöglichen. Und in diesen Kreisen wird musische Bildung schon in frühen Jahren großgeschrieben: Das durchschnittliche Einstiegsalter derer, die heute klassische Musik beruflich ausüben, beträgt 7,9 Jahre, das derer, die Popmusik spielen, immerhin noch 10 Jahre. In frühen Jahren übt sich, was mal ein Distinktionsvorteil werden will. Die deutsche Klassik- wie auch die Popszene strotzt vor Ärzte-, Apotheker-, Unternehmer-, Professoren-, mindestens aber Lehrer-Kindern. Ausnahmen bestätigen die Regel – doch Mark Fisher hat konstatiert, dass es zwar immer noch für Einzelne möglich sei, «aus der Arbeiterklasse aufzusteigen, aber nicht mit ihr». (4) Und das gilt erst recht für armutsbetroffene Kinder und Jugendliche mit internationalem Familienhintergrund. Diversity hat eben eine klassenbedingte Schlagseite, die in der Popkultur gerne und systematisch ausgeblendet wird.
Owen Hatherly hat in seinem glänzenden kleinen Buch (5) über eine großartige englische Band, nämlich Pulp, quasi im Vorbeigehen konstatiert, dass 60 Prozent der um das Jahr 2010 in den Top Ten der Charts platzierten britischen Künstler:innen und Bands eine Privatschule besucht hatten; im Jahr 1990 war es dagegen gerade mal ein Prozent. Mumford & Sons, Lily Allen, Laura Marling, Florence Welch, Coldplay und wie sie alle heißen – «die Popstar-Perspektive bleibt finanziell vor-versorgten Ex-Privatschülern vorbehalten» (Robert Rotifer). Und «Privatschüler» in England sind ja nicht einfach irgendwelche verwöhnte Mittelschichtskids, die eine Waldorfschule besuchen würden – «Privatschüler» beinhaltet dort die Zugehörigkeit zur Oberschicht und ist ein Luxus, der jahrelang Monat für Monat etliche Tausend Pfund kostet, und den sich nur wirklich Betuchte leisten können.
Die deutliche Mehrheit aller Berufsmusizierenden hierzulande, nämlich 58 Prozent, ist freiberuflich tätig, nur 19 Prozent sind sozialversicherungspflichtig angestellt; dies dürften vor allem Orchestermusiker:innen sein. 34 Prozent aller Berufsmusizierenden sind in der Künstlersozialkasse (KSK) versichert. Und was das Einkommen der Berufsmusiker:innen angeht, kommt die MIZ-Erhebung zu einem überraschenden Schluss: «Musik ist für viele professionelle Musiker:innen finanziell durchaus einträglich», wird da behauptet, denn das persönliche monatliche Nettoeinkommen aller Berufsmusizierenden liege bei im Durchschnitt 2.660 Euro; die Musiker:innen in einem Angestelltenverhältnis kommen demnach auf durchschnittlich knapp 3.000 Euro netto, die freiberuflichen immerhin noch auf 2.460 Euro. Es gebe zwar «durchaus prekäre Fälle», 19 Prozent verfügen nur über ein monatliches Nettoeinkommen von weniger als 1.500 Euro. Aber immerhin: Vier Prozent der Berufsmusizierenden nehmen mehr als 6.000 Euro netto ein, etwas mehr als ein Prozent sogar mehr als 10.000 Euro. Ihr da oben, wir da unten. Und wenn man Äpfel mit Birnen vergleicht, kommt man eben auf ein «finanziell durchaus einträgliches» Durchschnittseinkommen…
Hier zeigt sich ein grundsätzliches Problem, wenn es zu Einschätzungen der Musikszene kommt: Verallgemeinernde Aussagen machen wenig Sinn. Klar verdienen manche etablierte Filmkomponist:innen, Pop- und Schlagerstars oder angestellte Orchestermusiker:innen sehr ordentlich, zumal letztere häufig neben ihrer hochdotierten Festanstellung auch noch als Professoren an Musikhochschulen wirken. Andererseits krebsen viele selbständige Musiker:innen mit geringen Einnahmen eben an der Armutsgrenze entlang, wie auch die «Jazzstudie 2022» (6) zeigt, an der rund 1.000 Musiker:innen teilgenommen haben. (Zur Erinnerung: Die «repräsentative» Erhebung von MIZ und Allensbach hat 600 von 150.000-180.000 Musiker:innen befragt, im Gegensatz zu 1.000 von geschätzten 3.000 bis 5.000 Jazzmusiker:innen hier). (7) Jazz wird’s prekär: Danach haben 65 Prozent der Musiker:innen ein zu versteuerndes Jahreseinkommen von weniger als 20.000 Euro und 33 Prozent sogar weniger als 10.000 Euro. Knapp zwei Drittel aller Jazzmusiker:innen haben also weniger als 1.667 Euro monatlich zur Verfügung, und ein Drittel sogar weniger als 834 Euro! All diese Musiker:innen werden sich gewiss freuen, vom in der MIZ-Studie postulierten Musiker:innen-Durchschnittseinkommen von 2.660 Euro zu hören…
Grundsätzlich lässt sich festhalten: Die meisten Musiker:innen verdienen zu wenig. Und vor allem die selbständig arbeitenden Musiker:innen (also fast alle in den Bereichen Pop und Jazz) verdienen viel zu wenig – die meisten von ihnen können ihren Lebensunterhalt von den Einnahmen ihres Musiker:innen-Daseins nicht bestreiten. Dies hat zur Folge, dass Genres wie Popkultur oder Jazz immer mehr von Musiker:innen aus Mittel- und Oberschicht dominiert werden, die sich den Lebenskunst-Prekariats-Status aufgrund ihrer finanziellen Absicherung als eine Art fröhliches Boheme-Dasein leisten können. Wie bereits erwähnt, es gibt bisher keine belastbare soziologische Studie zur Herkunft der Protagonist:innen der Popkultur (Carolin Amlinger, Oliver Nachtwey, übernehmen Sie!), aber in meiner nun bereits 36 Jahre andauernden Tätigkeit in der Musikindustrie kann ich die mir bekannten Söhne und Töchter von Fliesenlegern, Maurern, Bauern, Tennislehrern oder Fabrikarbeitern an meinen zehn Fingern abzählen – während die meisten aus wohlhabenden, zum Teil sogar reichen Familien kommen, und das gilt für Musiker:innen, Künstler:innen, Manager:innen in Plattenfirmen oder Musikverlagen und für Konzertveranstalter gleichermaßen.
Und am Rande ein kleiner Exkurs: Während die selbständigen Musiker:innen 16.569 Euro im Jahr verdienen (und Frauen sogar nur 13.745 Euro), sieht es bei denen, die von der Vermarktung von Musik leben, ganz anders aus:
Der Jahresverdienst von Lucian Grainge, Vorsitzender und CEO von UMG, dürfte sich 2021 inklusive seiner Boni, die er vor allem für das Herauslösen von UMG aus dem Vivendi-Konzern und den erfolgreichen Börsengang erhalten hat, auf mehr als 150 Millionen Britische Pfund (mehr als 175 Millionen Euro) summiert haben, wie die britische Tageszeitung The Guardian errechnet hat. (8) Das ist, wie der Guardian anmerkt, ein höherer Betrag, als alle britischen Songwriter und Komponisten zusammen mit ihrer Musik im Jahr 2019 verdient haben, also alle britischen Komponist:innen und Textdichter:innen 2019 für die Nutzung ihrer Musik durch Streams oder Airplay im Radio sowie durch den Verkauf von Downloads und physischen Produkten (also CDs und Vinyl-Platten) erhalten haben laut der Regierungsbehörde «Intellectual Property Office» (IPO). Da nimmt sich sein von 2023 bis 2028 vereinbartes jährliches Grundgehalt von 5 Mio. US-Dollar plus eines jährlichen Bonus von bis zu weiteren 10 Mio. US-Dollar, abhängig von der «Performance» des Konzerns, fast schon bescheiden aus. Die Eigenkapitalkomponente von Grainges neuem Vertrag umfasst allerdings zusätzliche jährliche Zuschüsse in Höhe von 20 Mio. US-Dollar. Und falls die UMG-Aktien bis 2028 bestimmte Höhen erreichen, werden maximal weitere 100 Mio. US-Dollar an Grainge gezahlt, je zur Hälfte in UMG-Aktien und in UMG-Aktienoptionen. Im optimalen Fall wird Lucian Grainge für fünf Jahre satte 275 Millionen Dollar erhalten, also 55 Mio. US-Dollar jährlich. Die durchschnittlichen UMG-Angestellten kamen laut Geschäftsbericht des Konzerns im Jahr 2022 immerhin auch noch auf 155.122 US-Dollar, also fast zehn Mal so viel wie die durchschnittlichen Musiker:innen in Deutschland.
Doch Lucian Grainge ist nicht der einzige Topmanager der Musikindustrie, der astronomische Zahlungen erhält. Der neue CEO der Warner Music Group (WMG), Robert Kyncl, erhält ein jährliches Basisgehalt von zwei Millionen US-Dollar. Hinzu kommt ein an das Erreichen bestimmter Unternehmensziele gebundener Bonus von über drei Millionen Dollar. Außerdem erhält Kyncl ab dem ersten vollen Jahr in Diensten des Konzerns ein Paket an Aktienoptionen mit einem Volumen von zehn Millionen Dollar. Macht gut 15 Millionen Dollar im Jahr. Nice.
Aber das ist noch nicht alles: Zusätzlich erhält der neue CEO nach seinem ersten Jahr bei der WMG einmalig Optionen im Wert von noch einmal zehn Millionen Dollar; diese Optionen können über vier Jahre verteilt gezogen werden und sind ebenfalls ans Erreichen bestimmter Unternehmensziele geknüpft. Und weil Herr Kyncl für seinen neuen Job umziehen muss, nämlich nach New York, erhält er auch eine kleine Umzugshilfe von seinem neuen Arbeitgeber: Er kann Umzugskosten bis zur Höhe von, ähem, 500.000 Dollar zur Erstattung bei seinem neuen Arbeitgeber einreichen.
Oder denken wir an Michael Rapino, den CEO von Live Nation. Er hat im Jahr 2022 ein «Compensation Package» von insgesamt 139 Millionen Dollar erhalten. Davon sind 3 Mio. US-Dollar Grundgehalt, plus ein «Signing Bonus» in Höhe von 6 Mio. US-Dollar, weil Rapino einen neuen Fünfjahresvertrag als CEO unterschrieben hat. Hinzu kam ein 12-Mio.-Bonus für das erfolgreiche Geschäftsjahr und Aktienprämien in Höhe von 116 Mio. US-Dollar, die zum Teil erfolgsabhängig sind und über die fünf Vertragsjahre gestreckt werden. Und der Live-Nation-CFO Joe Berchtold kam immerhin noch auf ein ähnlich konstruiertes «Compensation Package» in Höhe von 52,4 Mio. US-Dollar. (9)
Der Chef des deutschen Konzert- und Ticketing-Großkonzerns und Quasi-Monopolisten CTS Eventim, Klaus-Peter Schulenberg, wurde durch Konzerte und vor allem durch sein umstrittenes Ticketing-Geschäft binnen gerade einmal 16 Jahren zum Dollar-Milliardär (10) und nicht nur zu einem der reichsten Deutschen, sondern ist mit seinem von «Forbes» auf 3,2 Mrd. US-Dollar geschätzten Vermögen auch auf Platz 905 der reichsten Menschen dieses Planeten. (11) Und die Musiker:innen, denen er sein Vermögen letztlich verdankt, bezeichnet Schulenberg schlicht als Teil «unserer Content-Pipeline».
Wenn ihr nach «Gangstern», nach «Mafia» im Brechtschen Dreigroschenoper-Sinne sucht… Oder denken wir an «Die Zuhälterballade», für unsere Zwecke aktualisiert: «Wir (die Musikindustrie) schützten sie (die Musiker:innen, via Urheberrecht und Verträgen), und sie ernährten uns. Es geht auch anders, doch so geht es auch»…
Nach der Pandemie: Kulturexistenzgeld statt Musiker:innen-Prekariat!
Wie problematisch die soziale Situation für die meisten freiberuflich tätigen Musiker:innen in Deutschland ist, hat wie unter einem Brennglas die Coronapandemie gezeigt. Ohne die staatlichen Hilfsprogramme wäre das Gros der selbständigen Musiker:innen untergegangen, weil die wichtigen Einnahmen aus Konzertgagen komplett weggefallen sind. Die Auffangprogramme von Bund und einigen Ländern – die, wie wir uns erinnern, mühsam erkämpft werden mussten – haben da einiges bewirkt, ohne allerdings an der grundsätzlichen Fragilität künstlerischer Existenzen etwas geändert zu haben. Und vergessen wir nicht, dass die großen Player sehr üppig mit zum Teil dreistelligen Millionenbeträgen subventioniert (der CTS Eventim-Konzern zum Beispiel mit mehr als 200 Millionen Euro), viele Künstler:innen, Freiberufler oder Einzelunternehmer dagegen wenig bis gar nicht bedacht wurden. Und jetzt, nach der Corona-Ära, stellt sich für viele Musiker:innen heraus, dass ihre musikalische Zukunft massiv gefährdet ist. Tourneen von Newcomer-Acts und kleineren Bands finden kaum Publikum und müssen nicht selten abgesagt werden, die fehlenden Einnahmen können nicht kompensiert werden.
Die staatlichen Hilfsprogramme waren notwendig und gut und schön, was aber fehlt, ist eine langfristige Existenzabsicherung der Künstler:innen. Was fehlt, ist ein Kulturexistenzgeld, also die längst überfällige grundsätzliche soziale Absicherung für Kreative und Kulturarbeiter:innen, also auch für all die selbständig tätigen Hilfskräfte wie Techniker:innen, Stagehands, Tourmanager:innen oder Cateringkräfte, die im Hintergrund arbeiten, aber Konzerte überhaupt erst möglich machen. Um es mit Brechts Dreigroschenfilm zu sagen: «Denn die einen sind im Dunkeln / Und die anderen sind im Licht. / Und man siehet die im Lichte / Die im Dunkeln sieht man nicht.» (12) Es wird allerhöchste Zeit, die Scheinwerfer auch auf die im Dunkeln Tätigen zu richten!
Das Kulturexistenzgeld könnte am besten durch eine Erweiterung der Künstlersozialkasse geschehen, die ja bereits eine Kranken- und Rentenversicherung für Kreative beinhaltet. Dem sollte eine dritte Säule hinzugefügt werden, eine Art Arbeitslosenversicherung, also eine Existenzsicherung für Künstler:innen und Kulturarbeiter:innen, die unverschuldet in Not geraten. Wie bei Kranken- und Rentenversicherung auch könnte das Kulturexistenzgeld jeweils anteilig durch Beiträge der Bezieher:innen und der Verwertungsindustrie finanziert werden. Und es würde sicher auch nicht schaden, wenn die Bundesregierung die von SPD und Grünen im Jahr 2000 vollzogene Kürzung des Bundeszuschusses zur KSK um ein Fünftel endlich rückgängig machen würde, sodass die Beiträge der Kreativen, aber auch der Verwerter sinken könnten.
Erinnern wir uns, wie die Künstlersozialkasse (KSK) in den 70er-Jahren erkämpft wurde. Da ist vor allem der Schriftsteller und SPD-Politiker Dieter Lattmann zu nennen, der nicht nur von 1969 bis 1974 Vorsitzender des von ihm mitbegründeten Verbandes deutscher Schriftsteller, sondern von 1972 bis 1980 auch Bundestagsabgeordneter war. Lattmann kämpfte innerhalb und außerhalb des Bundestags jahrelang und gegen teilweise erbitterte Widerstände der Verwertungsindustrie für diese soziale Errungenschaft und konnte sich der Unterstützung vor allem des SPD-Politikers Herbert Ehrenberg sicher sein, der von 1976 bis 1982 Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung war. Die Grundlage für das im Juli 1981 vom Bundestag beschlossene und am 1. Januar 1983 in Kraft getretene Künstlersozialversicherungsgesetz waren Untersuchungen zur sozialen Situation von Künstlern in der ersten Hälfte der 70er-Jahre, vor allem der Autorenreport und die Künstler-Enquete, auf denen 1975 der Künstlerbericht der Bundesregierung fußte.
Warum erwähne ich das so ausführlich? Weil sich aus der Entstehungsgeschichte der KSK einiges für die heutige Situation lernen lässt. Vor allem: Ohne Kampf und langen Atem gibt es keine sozialen Errungenschaften! Die bestehenden Verhältnisse sind keine Naturgesetze, sondern von (uns) Menschen gemacht, also veränderbar. Doch wo sind die Lattmanns und die Ehrenbergs unserer Tage? Wo sind die Kulturfunktionär:innen und Politiker:innen, die beharrlich für ein Kulturexistenzgeld als Erweiterung der KSK kämpfen? Zu Oppositionszeiten haben sich unter anderem einige Grünen-Politiker:innen wie zum Beispiel der Bundestagsabgeordnete Erhard Grundl für ein (im Vergleich zu meinem Vorschlag allerdings deutlich abgeschwächtes) Kulturexistenzgeld stark gemacht; wie zu hören war, sympathisierte auch Robert Habeck damit. Doch seit die Grünen Teil der Bundesregierung sind, scheinen derartige Konzepte bedauerlicherweise auf Eis gelegt – dabei wäre es doch gerade angesichts der zu erwartenden Zeitspanne, bis solch ein Konzept tatsächlich Gesetz wird, (denken wir an die sechs bis zehn Jahre, die das KSK-Gesetz seinerzeit benötigt hat!) dringlich, hier und heute mit dem Kampf für das Kulturexistenzgeld wenigstens zu beginnen.
Der Deutsche Kulturrat spricht in einer im Juni 2020 veröffentlichten Studie (13) von sage und schreibe über 719.000 selbständig Tätigen im Kulturbereich, davon knapp die Hälfte «Mini-Selbständige», deren Jahresumsatz unter 17.500 Euro liegt. In weiten Teilen des Kulturbetriebs herrschen also prekäre wirtschaftliche Verhältnisse (ganz abgesehen vom massiven Gendergap). Die Zahlen liegen auf dem Tisch. Doch anstatt endlich das Kulturexistenzgeld voranzutreiben, hat das BKM (14) die deutschen Musiker:innen während und nach der Pandemie ins Hamsterrad geschickt nach dem Motto «schaffe, schaffe, Werkle baue»: Gefördert wurden und werden neue Werke, also neue Alben, zusätzliche Konzerte und Tourneen. Und die staatliche «Initiative Musik», die «zentrale Fördereinrichtung der Bundesregierung und der Musikbranche für die deutsche Musikwirtschaft», initiiert allerlei mehr oder weniger sinnhaften Förderprogramme, in denen perverserweise auch regelmäßig Acts Förderungen erhalten, die bei den sogenannten «Majors», wie zum Beispiel beim weltgrößten Musikkonzern Universal, unter Vertrag stehen; die Universal Music Group (UMG) hat im Geschäftsjahr 2023 mit einem Rekordumsatz von 11,12 Mrd. Euro einen Gewinn (EBITDA) von 2,37 Milliarden Euro erzielt (15) – aber offensichtlich hat der Konzern nicht genug Geld, um seine eigenen Acts zu unterstützen, und lässt diese um Staatskohle betteln…
Popkulturförderung – vom Hamsterrad ins Mittelmaß…
Vor allem aber vergibt die Initiative Musik jährliche Preise: Den «Applaus» für Livemusikprogramme, den «Deutschen Jazzpreis» und neuerdings einen sogenannten «Akademie-Poppreis», für den die damalige Kulturstaatsministerin eigens eine «Akademie für Popmusik» ins Leben gerufen hat, in der allerdings nicht etwa ausschließlich Musiker:innen in Selbstverwaltung tätig sind, wie das bei Akademien eigentlich üblich ist, sondern auch Musikproduzenten, Musikverleger (!), Manager und einige Kulturfunktionär:innen – selbst bei großzügiger Zählweise sind gerade einmal 14 der 25 von der Ministerin im Feudalstil berufenen Akademieleute Musiker:innen, von Herbert Grönemeyer über Balbina bis hin zu Roland Kaiser, letzterer in der Tat ein ausgewiesener Popmusiker…
Die Konstruktion und das Ziel all dieser Preisverleihungen ist klar: Politiker:innen und Kulturfunktionär:innen können sich bei der Preisübergabe im Licht der Öffentlichkeit als Freunde der Künstler:innen inszenieren, und letztere sind selbst über die staatlichen Brosamen froh, weil ihre Lage eben prekär ist und eine Handvoll Euro besser als nichts. Zementiert wird mit der deutschen Popförderung, wie übrigens auch bei der ähnlich problematischen Filmförderung, vor allem das Mittelmaß; so wird «das deutsche Kino nun mal zum schlechtesten der Welt», wie Jens Friebe gesungen hat.
Die deutsche Popkultur-Förderung steckt in einer selbst betonierten Sackgasse. Die Fragilität der sozialen Verhältnisse der Musiker:innen und Kulturarbeiter:innen wird nicht nur hingenommen, sondern geradezu vorausgesetzt. Gleichzeitig werden vor allem Musiker:innen direkt gefördert, statt die Infrastruktur zu stärken. Und die Musiker:innen müssen permanent produzieren: neue Songs, neue Tracks, neue Alben, Shows, Tourneen. Nur wer ständig produktiv ist, verdient deutsche Förderung, nur wer ständig etwas herstellt und seine künstlerische Existenz an den gesellschaftlich gewollten Produktivitätsterror und die uneingeschränkte Warenförmigkeit anpasst, bekommt Geld von Claudia Roth & Co. Die vom Staat geförderten Musiker:innen müssen sich einer gnadenlos ökonomisierten Kulturpolitik unterwerfen, beziehungsweise sie werden, ob gewollt oder ungewollt, Teil der offiziellen Politik und des herrschenden Diktums, wonach Politik und Unternehmen verlangen, dass alle immer mehr arbeiten (obwohl doch längst schon immer mehr gearbeitet wird) – es geht um die permanente Steigerung der Produktivität. Musiker:innen und Künstler:innen, also die Mitglieder der vom Neoliberalismus verniedlichend und einhegend so bezeichneten «kreativen Klasse» könnten hier mit Marx in gewisser Weise als «konzeptive Ideologen» bezeichnet werden: Sie «dienen der herrschenden Klasse als das, wofür sie von dieser mit sehr bescheidenen Rechtsprivilegien ausgestattet worden sind», erklärte der Schriftsteller, Komponist und Wirtschaftshistoriker Hans G Helms bereits Mitte der 1970er-Jahre, also zu der Zeit, als aus der sozialliberalen Koalition heraus die Idee einer Künstlersozialkasse entwickelt wurde. Für Helms wirken die Komponist:innen und urhebenden Musiker:innen in der Bewusstseinsindustrie «an der Zementierung der kapitalistischen Klassengesellschaft mit». (16)
Hier kommen wir zu einem entscheidenden Punkt, der die vorne ausführlich beschriebene prekäre Situation der Musiker:innen und Künstler:innen mit der Tatsache verknüpft, dass Musik und überhaupt die Künste in dieser Gesellschaft vornehmlich von Menschen aus Mittel- und Oberschicht betrieben werden (Rapper:innen aus der Unterschicht und/oder mit internationalem Familienhintergrund dürfen als Ausnahme gelten, die diese These bestätigen). Wo Menschen, die Musik machen, von ihrer Musik nicht leben können, bleibt die Möglichkeit des Musikmachens auf die Schicht der finanziell vor-versorgten Menschen beschränkt.
Diese «höheren Töchter und sensiblen Söhne» (Dietmar Dath) sind dabei nicht nur die Produzent:innen von Kunst oder Popkultur, sondern sie besetzen im hiesigen Kulturbetrieb gleichzeitig die meisten Schaltstellen. Sie machen Musik, verlegen, lektorieren, kuratieren, produzieren und lassen produzieren. Und all die Künstler:innen, die ihre Förderanträge schreiben, die sie dann bei all den Förderinstitutionen einreichen, treffen dort wiederum auf all die anderen Leute ihrer Klasse, sie treffen auf ihresgleichen – die einen wissen, wie man die Anträge schreibt, die die anderen dann begutachten und mit Geld ausstatten. Es ist ein ganz eigener Kreislauf, in dem die höheren Töchter und sensiblen Söhne sich gegenseitig mit Staatskohle versorgen und in den kaum je ein Arbeitersohn oder eine Putzfrauen- oder Bauerntochter einbrechen wird. Papi bezahlt die Wohnung am Prenzlauer Berg oder in Friedrichshain, wo die höhere Tochter ihre achtsamen Emo-Songs schreibt und der sensible Sohn am Synthesizer frickelt. Und wenn mit der Popfirma der bourgeoisen Kinder mal etwas nicht so glatt laufen oder gar schief gehen sollte, helfen der Apotheker-Papa, die Arztfamilie, die Unternehmer-Eltern oder die wohlhabende Erbtante natürlich aus; die Künstler- und Kultur-Boheme fällt weich. «Um die Unsicherheit, das prekäre Leben als Freiheit genießen zu können, muss man behütet aufgewachsen sein» (Diedrich Diederichsen) und über die finanzielle Absicherung seiner Klasse verfügen. Entsprechend «von Haus aus» bevorzugt und zusätzlich mit staatlicher Förderung ausgestattet, kann man sich dann leicht als Pop-Kurator inszenieren, der in Interviews betont, «das Gewinnorientierte» stehe bei ihm «nicht auf Platz eins», er veranstalte nur Konzerte, an denen er selbst Spaß habe. Muss man sich eben leisten können…
Diese reale Kulturförderungspraxis ist letztlich geradezu inzestuös. Während die Kulturförderung eigentlich allen Menschen unabhängig von Schichtzugehörigkeit, Herkunft oder Bildungsstatus das Dasein als Musiker:in und Künstler:in ermöglichen sollte, und während die staatliche Kulturförderung dafür sorgen müsste, dass sowohl auf den Bühnen als auch dahinter, vor allem aber auch an den Schaltstellen der Kulturproduktion der gleiche Querschnitt der Gesellschaft tätig sein können muss wie diejenigen, die dies finanzieren, ist in der bundesdeutschen Gesellschaft eine staatlich geförderte und entsprechend staatstreue Mittelklasse-Kuratorenkunst und kuratierte Popmusik entstanden, in der nurmehr eine Horde von «Rich Kids» und Mittel- und Oberschichtsabkömmlingen sich die prekäre Existenz als Kulturproduzent:innen leisten kann. Deren «Staatstreue» zeigt sich in der Praxis darin, dass die staatlichen Institutionen durchaus ein paar kritische Töne zur Dekoration zulassen, um die eigene Liberalität auszustellen; diese Popkultur tut schließlich niemandem mehr weh, ihre Akteur:innen sind längst eingehegt, ihr Rebellentum in purem Habitus aufgegangen.
Art Schools, Arbeiterclubs, Counterculture und kalifornische Ideologie
Dabei gibt es etliche Beispiele, dass Popkultur gerade jenseits von eindimensionalen Förderprogrammen blühen kann. Die staatlich finanzierten Kunstschulen in Großbritannien, die «Art Schools», waren Brutstätten der Popkultur. «Leute wie Pete Townshend, Brian Eno oder Bryan Ferry konnten hier ohne großen ökonomischen Druck experimentieren» (Klaus Walter). Ein Mick Jagger profitierte wie viele andere britische Musiker:innen der 1960er- und 1970er-Jahre von einem großzügigen Uni-Stipendium. Sicher, es gab auch einige, die sich über die «Art School Boys» lustig machten, wie zum Beispiel die von John Peel vergötterten The Undertones in ihrem Song über den Musterknaben Kevin. (17) Aber letztlich ermöglichten die Art Schools Hand in Hand mit damals noch allgemein günstigen Lebensbedingungen einen experimentellen Freiraum, in dem Künstler:innen sich ohne wirtschaftliche Zwänge, ohne die Entwicklung eines kapitalistischen Egos ausprobieren konnten – sehr zum Vorteil der britischen Popkultur der 1960er- und 1970er-Jahre. Erst der Britpop, dieser «Jahrmarkt der Scheußlichkeiten», der «Laufsteg neoliberaler Gespenster und Zombies» (Matt Colquhoun (18) ), machte dem ein Ende.
Jenseits der Art-School-Szene existierten in den 1950ern und 1960ern in Großbritannien noch etliche der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begründeten Arbeiterclubs, zu denen Bühnen, Bars und nicht selten auch Bibliotheken gehörten. Mit vier Millionen Mitgliedern waren diese Arbeiterclubs zu Beginn der 1970er-Jahre eine der größten unabhängigen Vereinigungen weltweit. In dieser Zeit wandelten sie sich von Bildungs- und Freizeitstätten in Unterhaltungslokale und wurden so zu einem wichtigen Faktor für die Entwicklung der lokalen Musikszenen (19). Der spätere Popstar Tom Jones beispielsweise begann, wie viele andere Musiker aus der Arbeiterklasse, seine Karriere in einem walisischen Arbeiterclub, und Paul Weller und Steve Brookes von The Jam hatten ihre ersten Auftritte im örtlichen Arbeiterclub, in dem Paul Wellers Vater Mitglied war. Wellers Vater agierte zunächst auch als Manager von The Jam und besorgte der jungen Band Auftritte in anderen Arbeiterclubs. (20) Owen Hatherly verweist darauf, dass Pulp dann «die letzte große Band war, deren Mitglieder sich ihrer Zugehörigkeit zur Arbeiterklasse bewusst waren und sich gleichzeitig als Künstler verstanden» – siehe ihr «Konzeptalbum über den anhaltenden Klassenkampf», nämlich «Different Class».
Doch auch in den USA entstand in den 1960er-Jahren eine Bewegung, die einige kulturelle Macht entwickelte und für die Popkultur wie für die Gesellschaft an sich von großer Bedeutung war: die sogenannte Counterculture. Denken wir an das von den Musiker:innen selbst organisierte Monterey Pop Festival mit seiner einzigartigen künstlerischen Vielfalt (von Jimi Hendrix bis Ravi Shankar, von The Who bis Otis Redding, von The Grateful Dead über Hugh Masekela bis Janis Joplin), dem Statement von Miteinander, von Gleichheit und von Solidarität (alle Musiker:innen und Bands erhielten eine Spielzeit von 40 Minuten, alle traten ohne Gage auf, denn der Gewinn des Festivals ging an Solidaritätsprojekte in den schwarzen Ghettos) im Geist der Kommune («I saw a community form and live together for three days», sagte der Rolling Stone Brian Jones). Sicher, heute wissen wir, dass die sich in Monterey manifestierende kalifornische «Gegenkultur» mit ihrer Vision von «Music, Love and Flowers» (so das Banner an der Bühne in Monterey) letztlich im kalifornischen Kapitalismus mündete, der den Reichen und der oberen Mittelschicht zugute kommt, nicht aber den einfachen Arbeiter:innen, Verkäufer:innen und Dienstleistenden, die keine Gehälter von den erfolgreichen Silicon-Valley- oder Hollywood-Konzernen beziehen, und für die nur die Armenspeisung bleibt.
Die kalifornische Ideologie vermengt neoliberale Merksätze («We are pushing ourselves and our guests to do better and to be better» kann man auf der Coachella-Website lesen) mit Inhalten der Hippiebewegung. Es geht um Selbstverwirklichung, um eine Feier des Individualismus und des freien Marktes.
Mark Fisher beschreibt den Hippie als «durch und durch männliche Mittelschichtsfigur», definiert durch seine «hedonistische Kindlichkeit». (21) Und dennoch sieht Fisher «eine immanent transformative Unmittelbarkeit in der Musik der Gegenkultur. Sie verstärkte das Gefühl der Verzweiflung, der Unzufriedenheit und der Wut», insofern war die Musik jener Zeit tatsächlich bewusstseinsbildend und führte zu Aufruhr und mitunter gar zu Aufständen, oder doch wenigstens zu einem durch bewusstseinserweiternde Drogen gewonnenen Bewusstsein, «dass die gesellschaftliche Realität provisorisch und künstlich war und durch ein kollektives Begehren verändert werden konnte». Auch Herbert Marcuse sprach zu der Zeit ja von «Schönheit als eine Qualität», als «Negation der Warenwelt und der von ihr geforderten Leistungen», die sich in einer Oper Verdis genauso fände wie in einem Lied von Bob Dylan und «in einer Geste der Herzogin von Guermantes wie in der eines Hippiemädchens.» (22)
Die Gegenkultur war für die Mächtigen nicht nur wegen ihres aufrührerischen Charakters gefährlich, sondern vor allem auch aufgrund ihrer Vision des Nicht-Mitmachens. Grégoire Chamayou zitiert in seinem Buch «Die unregierbare Gesellschaft» die New York Times, die im Juni 1970 barmt, dass «die junge Generation, die bereits die Universitäten erschüttert hat», nun auch Unruhe in die Fabriken der USA bringe: «Viele junge Arbeiter fordern sofortige Änderungen ihrer Arbeitsbedingungen und verweigern die Fabrikdisziplin», wie es in einem internen Bericht von General Motors heiße. In der amerikanischen Automobilindustrie war die Fluktuation damals enorm: Mehr als die Hälfte der ungelernten Jungarbeiter verließ vor Ende des ersten Jahres den Arbeitsplatz, und allein bei General Motors blieben täglich fünf Prozent der Arbeiter ohne stichhaltige Begründung der Arbeit fern; montags und freitags verdoppelte sich diese Quote. «Wie kommt es, dass Sie nur vier Tage in der Woche arbeiten?», wurde 1973 ein Automobilarbeiter gefragt. «Weil ich in drei Tagen nicht genug zum Leben verdienen würde», war die freche Antwort. Allein während des Jahres 1970 traten nahezu zweieinhalb Millionen Arbeiter in den USA in den Streik. Und als 1972 die mit durchschnittlich 28 Jahren besonders junge Belegschaft des General-Motors-Werks in Lordstown in einen wilden Streik trat, sprach die Presse von einem «industriellen Woodstock».
Hippiemädchen, Antiproduktivität, Mieten und ein Leben ohne Angst
«1970 besucht ein Reporter des Wall Street Journal eine Fabrik. Am Band trifft er auf lange Haare, Bärte (…), vor allem aber auf ‹junge Gesichter, Augen voller Neugier, Augen, die den Protest im Land sich haben ausbreiten sehen. (…) Sie scheinen keine Angst zu haben.› Genau das ist, für die Unternehmerseite, das Hauptproblem.» (Chamayou) (23) Es war offensichtlich, dass sich das Establishment, das Kapital vor nichts mehr fürchten musste als davor, dass die jungen Menschen die «Fabrikdisziplin» verletzen und keine Angst mehr haben würden – dass die Arbeiter also Hippies werden könnten, wie es Mark Fisher formulierte. «In vielerlei Hinsicht war es der ununterbrochene Erfolg der Linken und der Gegenkultur in den Siebzigern, der das Kapital zwang, mit dem Neoliberalismus zu antworten», folgert er. Nicht zu Unrecht: «I’ll tell you what freedom is to me: no fear. I mean really: no fear!», sagte Nina Simone 1968 in einem Interview, und «Leben ohne Angst zu haben» heißt es in Helmut Richters 1962 entstandenem Gedicht «Erwartung», das Hanns Eisler für sein letztes Werk «Ernste Gesänge» bearbeitet hat. (24) Leben, ohne Angst zu haben, was für eine Vision! Diedrich Diederichsen sprach unlängst in einem Interview vom «alten Ideal der Unproduktivität oder Antiproduktivität, das reine Abhängen». Und er nennt außerdem einen wesentlichen Faktor für das Entstehen von Kunst und Musik in der New Yorker Neo-Avantgarde der Sechzigerjahre: günstige Mieten. «Tony Conrad und John Cale zahlten fünf Dollar Miete oder so. In der Lower East Side Manhattans, der Ludlow Street. Die brauchten kein Geld. Das ist Tony Conrads Resümee: Weil wir kein Geld brauchten, konnten wir das machen, was wir gemacht haben. Wer das erlebt habe, ziehe diese Freiheit immer dem Geldverdienen vor.» (25) Und die legendäre Factory Andy Warhols, des aus einer Bauernfamilie stammenden Industrie- und Werbegrafikers, konnte auch nur entstehen, weil die alten Fabrikhallen in New York, die Warhol für seine Ateliers benötigte, leer standen und günstig angemietet werden konnten. Nanette Flieg vom legendären SO36 in Berlin-Kreuzberg berichtet von der «Leichtigkeit» in den 1980er-Jahren: «Das Zimmer kostete 150 Mark, alles war spottbillig. Kein Geld zu brauchen, das war ein Luxus. Das hat uns Zeit und Kraft für alle möglichen Projekte gegeben: Das Haus instand halten, Kunst, Musik und Politik machen.» (26) Und vierzig Jahre später macht die Berliner Musikerin Katharina Kollmann aka Nichtseattle im Gespräch klar, dass sie zwar durchaus von ihrer Musik leben könne, dass dazu aber zum einen auch Tätigkeiten wie Chorleitung beitragen würden, zum anderen und vor allem aber auch eine günstige Miete.
Ja, Mietenpolitik ist Kulturpolitik! Und gerade dieses «weil wir kein Geld brauchten, konnten wir das machen, was wir gemacht haben» ist in Zeiten der fortgeschrittenen Gentrifizierung im kapitalistischen Realismus unserer Tage womöglich wichtiger denn je – auch wenn man vielleicht konstatieren muss, dass Veränderungen an diesem Zustand fast schon undenkbar scheinen und ein Boheme-Leben in legerer Unproduktivität in Städten wie New York, Berlin oder Beijing heutzutage wirklich nur noch Rich Kids und Expats vorbehalten ist.
Was tun? You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one…
Was tun?
Wir benötigen keinen Staatspop, wir brauchen keine Almosen von der Staatsministerin für Kultur, und wir brauchen auch keine depperten Pop- oder Jazzpreise (und übrigens auch keine mit viel öffentlichem Geld ausgestatteten Stadtmarketingveranstaltungen…) – was wir benötigen, ist zuvörderst zweierlei: eine soziale Absicherung der Musiker:innen und Künstler:innen, eben das Kulturexistenzgeld, das auch Menschen aus nicht wohlhabenden Familien die kulturelle Betätigung erlaubt. Und eine konsequente und umfassende institutionelle Förderung von Kulturorten, also von Clubs, Kulturzentren, Veranstaltungsorten, aber auch von unabhängigen Konzertveranstalter:innen. Dies wäre alles andere als ein großzügiges Geschenk von Bund, Ländern und Kommunen. Vielmehr muss die institutionelle Förderung von Kulturorten der Zeitkultur eine Selbstverständlichkeit werden und das gute Recht in einer Gesellschaft, die sich zur kulturellen Vielfalt verpflichtet hat.
Stichwort gesetzlicher Kulturorteschutz: Während der Pandemie wurde vom Bundestag mit großer Mehrheit die seit Ewigkeiten überfällige Aufwertung von Clubs und Venues zu Kulturstätten beschlossen. Dieser Parlamentsbeschluss harrt allerdings Jahre später immer noch der Umsetzung, bis heute sind die Veranstaltungsorte baurechtlich Bordellen oder Glücksspielhöllen gleichgesetzt. Die Kulturorte benötigen weitergehende Unterstützung und Sicherheit: Ein gesetzlicher Kulturraumschutz ist überfällig! Ein Schutz, der für Opern- und klassische Konzerthäuser natürlich längst existiert – niemand würde auf die Idee kommen, die Berliner Philharmonie oder die Staatsoper abreißen zu lassen, damit an deren Stelle von privaten Investoren finanzierte, hochpreisige Luxuswohnungen oder Bürogebäude errichtet werden können. Für die Orte der Popkultur ist dies jedoch gang und gäbe, die staatlich geförderte Gentrifizierung sorgt für die Vernichtung wertvoller unabhängiger Kulturorte. Wo aber soll der popkulturelle Nachwuchs gefördert werden? Die Popkultur wächst nicht in den Stadien, wo Superstars zu Superticketpreisen spielen und Superprofite für sich selbst und für internationale Großkonzerne generieren, sondern sie wächst in den Clubs. Die Stars von morgen wachsen auf Club-Bühnen. Erst Clubs, Venues und unabhängige Veranstalter sorgen für die gesetzlich garantierte kulturelle Vielfalt unserer Gesellschaft – gerade auch, indem sie Entfaltungsräume für Musiker:innen abseits des Mainstreams bieten.
Stichwort institutionelle Förderung: Die Kulturorte und auch die unabhängigen Veranstalter:innen müssen eine umfassende finanzielle Förderung erhalten. Dies gilt für Mieten, Veranstaltungstechnik (27) und Personalkosten (die jeweils anteilig übernommen beziehungsweise bezuschusst werden müssen; über die Details muss man sich verständigen), aber auch für einen Teil des Veranstaltungsangebots, nämlich vor allem für die kleineren Konzerte und solche der Newcomer:innen, also für die Nachwuchs- und Aufbauarbeit neuer Musiker:innen. Diese Konzerte sind angesichts drastisch gestiegener Kosten ohne Förderung schon lange nicht mehr durchführbar. Anstatt einige Musiker:innen direkt mit Staatszuschüssen in neofeudaler Manier zu versorgen, muss die Entscheidung wieder an die Popkulturszene zurückverlagert werden. Wenn Kulturorte und unabhängige Veranstalter:innen finanziell ausreichend ausgestattet sind, kann die Popkultur in den Kulturorten wieder selbstverwaltet und als sich selbst organisierende Community agieren, jenseits von staatlichen Förderanträgen und permanentem Produktivitätszwang.
Wir sprechen hier nicht von einer Neugestaltung der Kulturförderung, sondern von einer überfälligen Gleichstellung der Zeitkultur mit der sogenannten Hochkultur. Auch bei Philharmonien, Theatern und Opernhäusern werden ja nicht einzelne Musiker:innen vom Staat subventioniert, sondern eben die Institutionen, die vollkommen unabhängig in ihrer Programmarbeit sind und denen es obliegt, ein breites Spektrum von Veranstaltungen anzubieten und dafür Sorge zu tragen, dass die Musiker:innen, aber auch die Angestellten im Produktionsbereich der Häuser vernünftig von ihrer Arbeit leben können.
Und das Gute an der Zeitkultur ist ja: um sie aufrechtzuerhalten, wird wesentlich weniger Geld benötigt als für Opern- und Konzerthäuser, allein schon, weil in Pop oder Jazz keine riesigen Ensembles durchzufinanzieren sind. Hier würde bereits ein Bruchteil der Fördermittel, die für die «Klassik» ausgegeben werden, ausreichen, um das vielfältige und spannende Programm der Zeitkultur abzusichern.
Mittels einer entsprechenden Förderung könnte endlich auch im Popkultur- und Jazzbereich eine Mindestgagenregelung umgesetzt werden. Für kleine Konzerte bis sagen wir 150 oder 200 verkaufte Tickets sollte eine Mindestgage von 250 Euro pro Musiker:in und Auftritt vorgeschrieben werden (analog zur derzeit gültigen «Milderungsregel», unterhalb der für ausländische Musiker:innen keine Ausländersteuer anfällt); bei Konzerten mit mehr Fans erhalten die Musiker:innen ja auch jetzt schon angemessene Gagen. Mit diesen Mindestgagen würden Musiker:innen von Popkultur, Jazz oder anderen Genres der Zeitkultur den selbständigen Musiker:innen der sogenannten Hochkultur wenigstens ein wenig gleichgestellt werden, für die die Kulturministerkonferenz bereits im Herbst 2022 eine «Honorarmatrix» mit verbindlichen Basishonoraren verabschiedet hat, die ab diesem Jahr zum Tragen kommt. Vor allem würde eine derartige Mindestgage auch Musiker:innen, die nicht aus wohlhabenden Familien stammen, ein Auskommen ermöglichen. Für Amateurmusiker:innen und Support-Acts müssen natürlich Ausnahmeregelungen geschaffen werden.
Klingt alles völlig verrückt und utopisch? «You may say I’m a dreamer / But I’m not the only one.» In Frankreich sind viele dieser Forderungen (und noch einige mehr) bereits seit den 1980er-Jahren Realität, als der großartige Kulturminister Jack Lang in der Ära François Mitterand nicht nur 1982 die Fête de la Musique ins Leben rief, sondern eine umfassende soziale Absicherung von selbständigen Künstler:innen organisierte, die weit über das oben geforderte Kulturexistenzgeld hinausgeht, und die Gründung zahlreicher Kulturhäuser in den Provinzen anstieß und für ihre langfristige Finanzierung samt Infrastrukturförderung sorgte. Interessant ist in diesem Zusammenhang übrigens, dass die Musikszene Frankreichs wesentlich besser aus dem Tief der Corona-Pandemie herausgekommen ist als die deutsche. (28) Und die internationalen Großkonzerne, die Live Nations, CTS Eventims oder AEGs tun sich in unserem Nachbarland auch wesentlich schwerer. Eine engagierte Kulturpolitik, die sich sowohl der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse als auch der Kulturorte annimmt, kann langfristig viel zum Guten verändern. Frankreich, du hast es besser!
Was die Finanzierung angeht, gibt es verschiedenste Möglichkeiten, nicht ausschließlich durch Zugriff auf die öffentlichen Haushalte. Sinnvoll erscheint beispielsweise ein verpflichtender Solidarbeitrag von zunächst einem Euro, den die Ticketingkonzerne für jedes verkaufte Ticket von Konzerten mit einem Ticketpreis von 50 Euro aufwärts zugunsten der unabhängigen Konzertszene abführen müssen. Die Vorverkaufsgebühren betragen in aller Regel zehn Prozent und mehr – wenn die Ticketingkonzerne, die ihr Provisionsgeschäft ja ohne jedes finanzielle Risiko betreiben, von fünf (und deutlich mehr) Euro einen abgeben müssen, geht ihre Welt wahrlich nicht unter – der unabhängigen Szene aber ist damit mächtig geholfen.
Ein Beispiel: Ein internationaler Großkonzern veranstaltet in München diesen Sommer zehn Open-Air-Konzerte mit Adele und hat zu diesem Zweck ein städtisches Gelände von der Stadt gepachtet. Erwartet werden rund 800.000 Zuschauer, die Ticketpreise liegen bei mehreren Hundert Euro – wie viele engagierte Nachwuchsprogramme, Konzerte mit kleineren Bands oder nichtkommerzielle Clubnächte könnte die darbende Münchner Club-, Konzert- und Veranstaltungsszene mit 800.000 Euro nach obigem Modell gestalten!
Es wird Zeit, dass sich die Musiker:innen und Kulturarbeiter:innen, die Clubbetreiber, die unabhängigen Konzertveranstalter:innen und alle, denen die kulturelle Vielfalt ein Anliegen ist, gegen die extrem ungleiche Verteilung der Einkommens- und Besitzverhältnisse in der gesamten Musikindustrie wehren.
Es wird Zeit, dass wir für ein Kulturexistenzgeld, für einen gesetzlichen Kulturraumschutz und für die Gleichstellung der Veranstaltungsstätten der Zeitkultur mit den Kulturtempeln der Hochkultur sowie für eine ausreichende finanzielle Ausstattung, also eine institutionelle Förderung der Popkultur und ihrer Spielstätten kämpfen. Wir müssen unsere Belange selbst in die Hand nehmen. Und unsere Belange sind zuvörderst: institutionell geförderte, unabhängige Kulturorte in möglichst großer Zahl und Vielfalt sowie finanziell würdige Bedingungen für Musiker*innen und Künstler*innen aller Art.
Der Einsatz für Utopien ist derzeit nicht gerade in Mode. Doch nehmen wir uns ein Beispiel an dem «närrischen Alten» Yú Gōng, eines der bekanntesten chinesischen Gleichnisse, das der chinesische Denker Lie Zi vor etwa 2400 Jahren aufgeschrieben hat. Yú Gōng, ein Greis, der auf die Neunzig zugeht, beschließt, zusammen mit seinen Söhnen zwei Berge abzutragen, die ihm den Weg und die Sicht versperren. Seine Frau und ein weiser Alter haben Zweifel, der Weise macht sich sogar über ihn lustig: «Wie tief ist doch deine Dummheit! Mit der verbleibenden Kraft deiner letzten Jahre vermagst du nicht einmal einen Grashalm zu rupfen, ganz zu schweigen von Stein und Erde.» Doch der Alte entgegnet: «Auch wenn ich sterben sollte, ist da noch mein Sohn am Leben. Der Sohn wird einen Enkel haben, dessen Sohn wiederum einen Sohn, und dieser Sohn einen Enkel. Und das wird nie ein Ende nehmen. Der Berg aber wächst nicht weiter. Warum sich also Sorgen machen, man könne ihn nicht abtragen?» Und mit Hilfe aus der Götterwelt werden die Berge tatsächlich versetzt. Aus diesem mehr als zwei Jahrtausende alten Gleichnis ist das chinesische Sprichwort «yú gōng yí shān» (Yú Gōng versetzt Berge) geworden. (29)
Utopien können Berge versetzen. Wir müssen nur beginnen, für sie zu kämpfen.
Fußnoten & Anmerkungen
1 Entwicklung des Einkommens der Versicherten zum 01.01.2024, in: KSK in Zahlen, auf kuenstlersozialkasse.de, abgerufen am 22.04.2024.
2 Laut Mindestlohnrechner auf der Website des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.
3 Deutscher Musikrat / Deutsches Musikinformationszentrum (miz) in Kooperation mit dem Institut für Demoskopie Allensbach (IfD) (Hg.): Professionelles Musizieren in Deutschland, Bonn 2023.
4 Mark Fisher: Kapitalistischer Realismus ohne Alternative? Eine Flugschrift, Hamburg 2013.
5 Owen Hatherly: These Glory Days, deutsch von Sylvia Prahl, Berlin 2012.
6 Deutsche Jazzunion (Hg.): Jazzstudie 2022. Lebens- und Arbeitsbedingungen von Jazzmusiker*innen in Deutschland, Berlin 2022.
7 Im Jahr 2007 rechnete Arndt Weidler vom Jazzinstitut Darmstadt mit 3.000 Jazz-Musiker:innen, während die Union Deutsche Jazzmusiker von «bis zu 10.000» ausging (F.A.Z. vom 1.3.2007). Im Jahr 2022 waren insgesamt knapp 12.000 Musiker:innen im Bereich Rock/Pop/Jazz als berufsbedingt Versicherte bei der KSK versichert, daher kann eher von gut 3.000, höchstens 5.000 Jazz-Musiker:innen ausgegangen werden.
8 »MPs and music industry bodies criticize pay of Universal head Lucian Grange», The Guardian, 10.11.2021.
9 Caitlin Huston: «Live Nation CEO Michael Rapino’s Total Pay Jumps to $139M in 2022». In: Billboard vom 01.05.2023.
10 «Bloomberg-Index führt Schulenberg als Dollar-Milliardär». In: Musikwoche.de vom 27.06.2013.
11 «The Richest People In The World». In: Forbes.com, abgerufen am 10.06.2023.
12 Bertolt Brecht: Die Schlussstrophen des Dreigroschenfilms, in: ders., Die Gedichte in einem Band, Frankfurt a. M. 1981.
13 Gabriele Schulz, Olaf Zimmermann: Frauen und Männer im Kulturmarkt. Bericht zur sozialen und wirtschaftlichen Lage. Herausgegeben vom Deutschen Kulturrat, Berlin 2020.
14 Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien
15 Knut Schlinger: Universal Music knackt Elf-Milliarden-Marke, in: Musikwoche.de am 28.02.2024.
16 Hans G Helms, Musik nach dem Gesetz der Ware (1973/1975), in: Ders., Musik zwischen Geschäft und Unwahrheit, Berlin 2001.
17 «His mother bought him a synthesizer, got the Human League in to advise her, now he’s making lots of noise, playing along with the art school boys.» (The Undertones, «My perfect cousin»).
18 Matt Colquhoun, Nie wieder triste Montagmorgen. Vorwort zu: Mark Fisher, Sehnsucht nach dem Kapitalismus, Berlin 2023.
19 Siehe Harald Trapp, Robert Thum, Brian Hoy, «Working Men’s Club», Arch+ features 76, London 2018; als Einhefter in: Arch+ Nr. 232, Aachen 2018.
20 Ich beschreibe die Arbeiterclubs als wichtigen Faktor für die Entwicklung der britischen Popkultur ausführlich im 3. Kapitel von: Vom Imperiengeschäft, Berlin 2019.
21 Mark Fisher: k-punk. Ausgewählte Schriften (2004-2016), Berlin 2020.
22 Herbert Marcuse, Kunst und Revolution, in: Konterrevolution und Revolte (1972), in ders., Schriften 9, Frankfurt a. M. 1987.
23 Grégoire Chamayou: Die unregierbare Gesellschaft. Eine Genealogie des autoritären Liberalismus, Berlin 2019.
24 Hanns Eisler: «XX. Parteitag (nach einem Gedicht von Helmut Richter)», Georg Nigl/Ingo Metzmacher/ Philharmonisches Staatsorchester Hamburg, live 25.08.2021 Elbphilharmonie - https://youtu.be/xm7Wcy0qRAw?si=U6gPTbqKieJxdYV5 (09:40)
25 Diedrich Diederichsen im Interview mit Tobi Müller: «Das Ästhetische zu meiden, ist wie Selbstmord aus Angst vor dem Tod», in: WOZ Die Wochenzeitung vom 07.03.2024
26 Nanette Flieg im Interview mit Jessica Gummersbach: «Sprecherin des SO36: Kreuzberg wird nicht so untergehen wie Prenzlauer Berg», in: Tagesspiegel vom 3. Mai 2024.
27 Nach Fertigstellung dieses Aufsatzes veröffentlichte die staatliche Initiative Musik ein neues Förderprogramm namens «PlugIn». Hier werden «Livemusikspielstätten» mit zwischen 900 und 15.000 Euro «bei der Optimierung ihrer Konzerttechnik» unterstützt, wobei zwischen 10 und 50 Prozent der Gesamtausgaben als Eigenanteil von den Spielstätten selbst getragen werden müssen. Für dieses Programm steht gerade einmal eine Million Euro zur Verfügung – kaum mehr als ein Tropfen auf den heißen Tanzboden unserer Clubs und Venues. Aber immerhin…
28 Siehe auch die Vergleichsstudie Centre National de la Musique, Soutenir la filière musicale en période de pandémie : quelles réponses des États en Europe? September 2021.
29 Yu Gong Yi Shan hat sich 2004 auch einer der wichtigsten Underground-Musikclubs Beijings genannt, der bis 2007 in einem winzigen Gebäude auf einem Parkplatz nahe des Worker’s Stadium existierte, dann im Zuge der Olympischen Spiele von dort weggentrifiziert wurde und seit Herbst 2007 im Dongcheng-Distrikt der chinesischen Hauptstadt weiterlebt. Ich verwende hier die Übersetzung von Wolfgang Kubin: Lie Zi, Von der Kunst, auf dem Wind zu reiten. Ausgewählt, übersetzt und kommentiert von Wolfgang Kubin, Freiburg im Breisgau 2017, S. 126 ff.
Musikbusiness neu denken. Diesen und viele weitere Texte findest du in den Low Budget High Spirit Magazinen.
-
Das Magazin - Ausgabe 2025
Normaler Preis CHF 10.00Normaler PreisGrundpreis pro -
Das Magazin - Ausgabe 2024
Normaler Preis CHF 10.00Normaler PreisGrundpreis pro -
Das Magazin - Bundle 2025 & 2024
Normaler Preis CHF 16.00Normaler PreisGrundpreis pro -
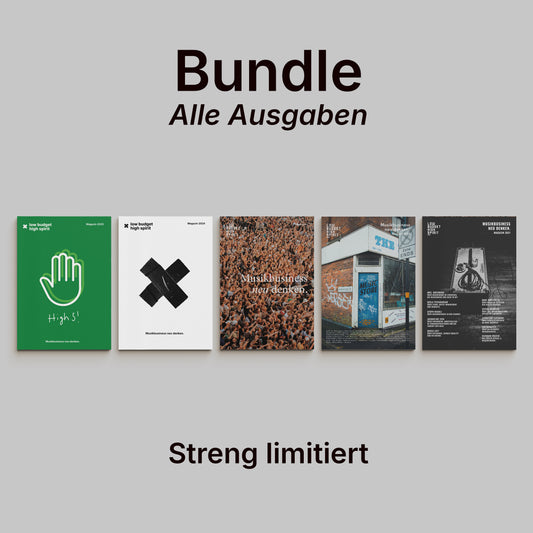 Ausverkauft
AusverkauftDas Magazin - Bundle Alle Ausgaben
Normaler Preis CHF 33.00Normaler PreisGrundpreis pro