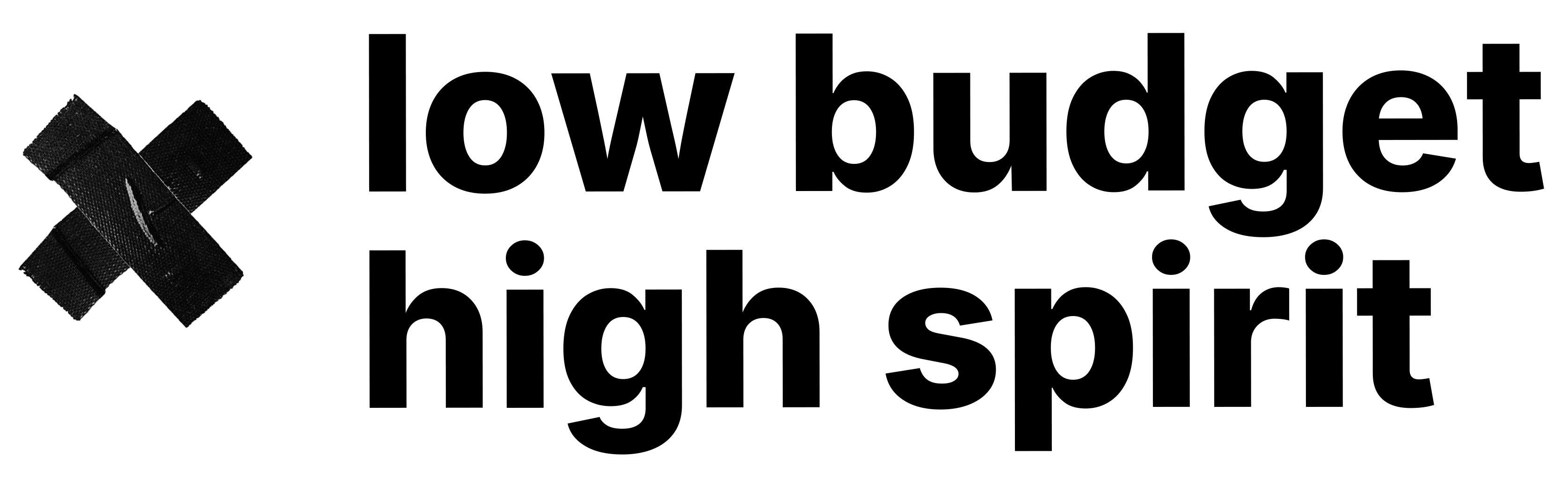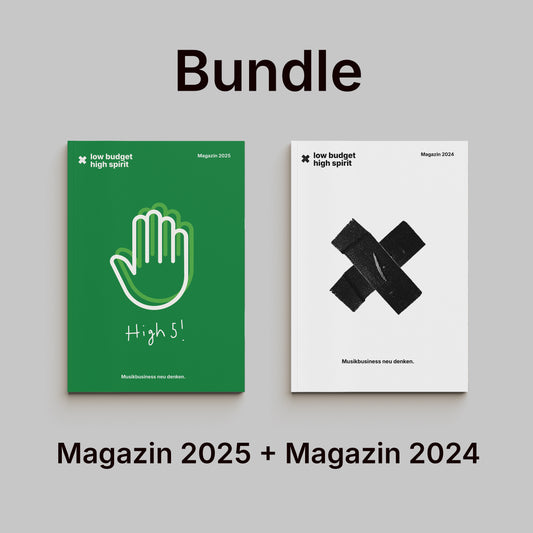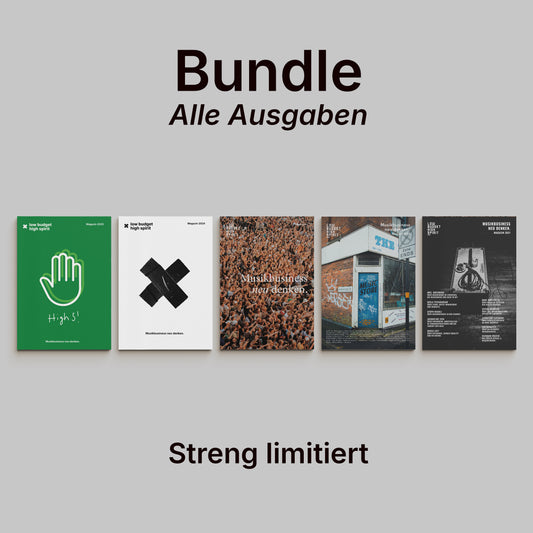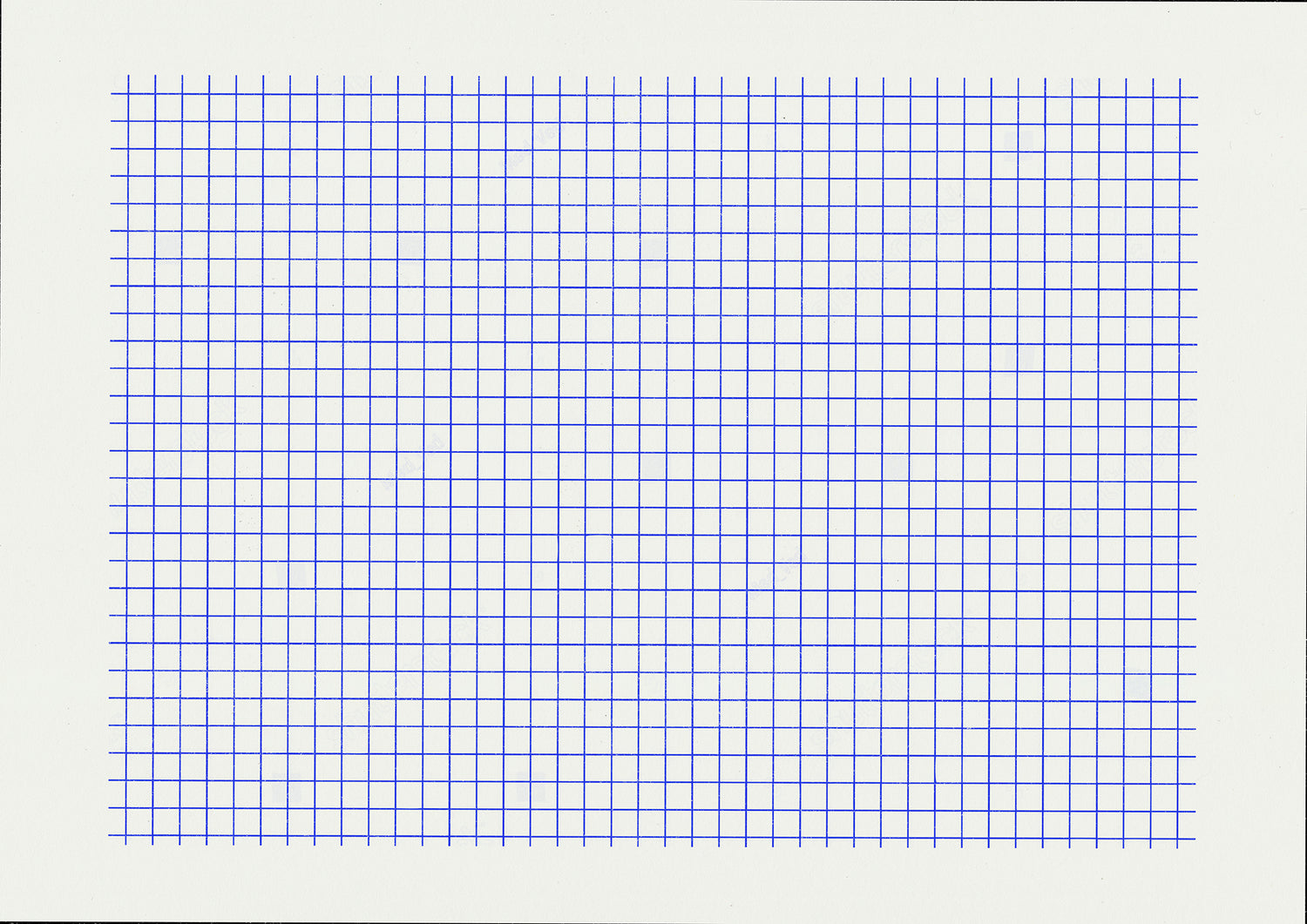Bedrohte Spezies – wie ACT das Jazz-Label der Zukunft baut
Fab Schuetze zu Besuch bei Andreas Brandis
Mehr zu ACT via actmusic.com.
Mehr zu Andreas Brandis via andreasbrandis.de.
Musikbusiness aus dem Bereich Jazz hat hier bei Low Budget High Spirit bislang eine eher ungeordnete Rolle gespielt. Das Genre hat besondere Spezifikationen – akademisiert, öffentlich gefördert und eine komplett eigene Festival-, Club- und Label-Landschaft. Eine Szene, der immer noch der Ruf anhaftet, altbacken, publikumsvergessen und alles andere als innovativ zu sein, wenn es um die Herausforderungen der heutigen Zeit geht: Streaming und Socials. Zeit, mit diesen (und meinen) Vorurteilen aufzuräumen und sich das alles einordnen zu lassen. Am besten von jemandem, der belegbar ein modernes, vielseitiges und erfolgreiches Unternehmen im Bereich Jazz führt: Andreas Brandis von ACT.
Berliner Mitte, Hinterhof, hohe Decken. An den Wänden die serielle und wohlbekannte visuelle Identität von ACT in Form von Album-Artworks. Andreas Brandis kommt mit Kompagnon, einem kleinen Hund, in die Küche geschlendert. Lotti folgt Brandis auf Schritt und Tritt und unterbricht sogar Ruhepausen auf der Couch, um den Chef die anderthalb Meter bis zur Espressomaschine und zurück zu begleiten. Es gibt Croissants, guten Kaffee und einen sehr gut aufgelegten Andreas Brandis. Der gebürtige Heidelberger hat vorher für Majors und Indies in vielen verschiedenen Genres gearbeitet. Seit mittlerweile 10 Jahren leitet er mit ACT ein Unternehmen, das 16 Mitarbeiter*innen beschäftigt und heute weit mehr ist als ein Label. Was man sofort merkt: Brandis hat Bock. Kein Jammern, kein Lamento, sondern: Tatendrang und die Lust am Machen, Experimentieren und Teilen bestimmen das Gespräch. Am Ende wird sich Brandis dafür drei Stunden Zeit genommen haben.
Das produzierende Label
Während der Recherche fällt mir auf, dass die zwei stilprägenden und international bedeutenden Jazz-Labels aus Deutschland bei ihrem Namen mit drei Buchstaben (in All Capitals) auskommen: ECM und ACT. Was ist das? Deutscher Minimalismus, Trockenheit made in Germany, Bauhaus-Moderne? Die Strenge bei den Artworks lässt es vermuten. Und noch etwas eint die beiden Firmen: Sie verstehen sich als produzierende Labels. Das ist im Pop, im Indie, in der elektronischen Musik (und überall anders auch) mehr als unüblich. Dort wird im Normalfall das fertige Master angeliefert und für 10 bis 20 Jahre lizenziert, oder es werden gar nur noch Vertriebsrechte eingeräumt. Der Unterschied zum produzierenden Label ist in Sachen Rechte enorm: Hier wird also häufig kein Bandübernahmevertrag verhandelt. Die Metriken funktionieren andersherum, die Musiker werden an den Erlösen der ACT-Produktion beteiligt. ACT produziert das Album im Wortsinn.
Vor diesem Hintergrund ergibt der unbedingte Zwang zur visuellen Identität von ACT bei den Cover-Artworks noch mehr Sinn. Jedes Design folgt einem festen Framework: ganz viel Whitespace, ACT-Logo, Artist und Titel des Releases in festgelegter Font, visuelles (fast immer illustrativ abstraktes) Element: fertig. Und das schon immer.
ACT Live
Am Ende ist es diese visuelle Identität und der hochgradig kuratierte Katalog, die ACT heute zu den bekanntesten Jazz-Marken in Deutschland und mindestens Europa macht. Wie wichtig der Faktor Marke ist, zeigt sich besonders bei Gegenwind. Denn: Streaming, Socials und Jazz sind nicht unbedingt die besten Freunde. Und auch im Jazz werden deutlich weniger Tonträger verkauft als früher. Es geht also auch und vor allem darum, wie ein Unternehmen heutzutage mit diesen Herausforderungen klarkommt. Fest steht: Mit einer etablierten und starken Marke wird es deutlich einfacher, das Geschäft zu diversifizieren.
«Es ging von Anfang an darum, das 1992 vom Musikproduzenten und -manager Siggi Loch gegründete und etablierte Unternehmen in die Zukunft zu führen. Uns war klar, dass es nicht reichen wird, einfach nur zu verwalten und zuzuschauen, wie es immer weniger wird – und dann nur noch die Prozesse zu straffen, um es irgendwie profitabel zu halten. Gleichzeitig war uns auch bewusst, dass wir trotzdem weiter, ganz klassisch, ein produzierendes Label sein wollen, viele Kompetenzen inhouse haben wollen und nicht einfach nur ein Serviceunternehmen sind, das Releases rausstellt. Dass das mit physischen und digitalen Verkäufen allein nicht mehr möglich sein wird, war uns zum Glück früh klar.»
ACT gründet 2017 die Division The ACT Agency aus. Was mit ersten Management- und Bookingaktivitäten für Michael Wollny beginnt, ist heute eine Live-Agentur, die für ein Roster zwischen Jazz und Klassik über 500 Konzerte pro Jahr in Europa bucht, darunter auch selbst veranstaltete Formate und Abende, vorrangig in Berlin. Von den 16 Angestellten der Firma arbeiten inzwischen 7 Menschen im Live-Bereich. Die Artists sind auch, aber nicht ausschließlich auch Label-Artists.
«Heute ist ACT eine 360°-Marke für aktuelle Musik im Spirit des Jazz – also weit über dessen Genregrenzen und gängige Klischees hinaus. Wir können unsere Künstler*innen heute in allen Belangen begleiten, die für ihre Karriere wichtig sind. Das begann mit: Wir machen Management für ausgewählte Künstler*innen und wir buchen ganz klassisch Touren, oder buchen den Act auf Festivals. Aber wir waren dann schnell an dem Punkt, dass wir darüber nachgedacht haben, wie sich unsere Label-Skills auf das Agenturgeschäft übertragen lassen. Da war schnell klar: Wir müssen eigene Konzertformate entwickeln. Wir müssen dafür auch der Veranstalter sein, um solche konzeptionellen Sachen gut umsetzen zu können. Haben wir ein Format erfolgreich in Berlin etabliert, denken wir im nächsten Schritt darüber nach, den Abend auch in anderen Städten zu machen. Dafür haben wir zum Glück ein sehr gutes Netzwerk aus klassischen Häusern. Klar war das am Anfang auch eine riesige Investition und gerade während der Pandemie hat das oft auch keinen Spaß gemacht. Aber jetzt haben wir ein gut aufgebautes Publikum und jetzt kann man damit auch Geld verdienen.Wir sind da auch sehr hands on: Wir stehen selbst an der Kasse, wir verkaufen den Merch, wir sind vor Ort.»
Bedrohte Spezies
Viele Labels, die es heutzutage nicht mehr gibt oder denen es schlecht geht, haben einen Fehler gemacht: sich nicht genug um ihre Marke zu kümmern. Das passiert natürlich einmal auf der Ebene der Musik: Verwässerung, egal, ob qualitativ oder inhaltlich, hat noch keinem gutgetan. Aber ganz viel Brandbuilding passiert natürlich auf der visuellen und kommunikativen Ebene: Hier hebelt Stringenz über 30 Jahre hinweg massiv. ACT hat mit Sicherheit vieles richtig gemacht. Dennoch:
Schaue ich auf ACT, sehe ich eigentlich den Prototyp einer (international) bedrohten Spezies: das mittelständische Label. Relevant viele Angestellte, die enorme Kosten produzieren. Ambitionierte Produktionen und Investitionen. Ein schlankes Team, aber nicht klein genug, um im Zweifel mit Nudeln und Ketchup durch die Krise zu kommen. Gleichzeitig nicht groß genug, um als Tanker lange durch unruhiges Gewässer zu fahren. Krisen wie die Covid-Pandemie gehen auch an ACT nicht spurlos vorbei, und es ist auch keine Selbstverständlichkeit, über 30 Jahre (und darüber hinaus) ein angesagtes Label in einem Segment des Marktes zu sein. Wie gut ist ACT gegen die Risiken des Marktes abgesichert?
«Zentral ist natürlich die Labelmarke, die ein großes, eigenes Following hat. Das haben viele andere einfach versäumt. Das ist nicht nur wichtig für die Verkäufe, sondern auch für die Live-Abende. Auch Business-seitig strahlt die Labelmarke natürlich stark auf die Live-Agentur und hilft uns dort sehr. Dann ist da der Katalog. Der ist so groß, dass er beständig Umsätze macht. Das Nächste ist die Nische: Wir profitieren davon, dass das Jazz-Publikum viel treuer gegenüber den physischen Formaten ist als in vielen anderen Genres, viel bewusster Musik hört und Wert auf Persönlichkeit und Authentizität legt. Nicht zuletzt haben wir alle Kompetenzen inhouse, das hat auch viele Vorteile, weil wir so auch den Artists weiterhin ein sehr gutes Angebot machen können. Ich halte uns für gut aufgestellt, auch wenn es für alle im Indie-Bereich ein Tanz auf dem Drahtseil bleibt. Die Zeiten sind einfach schwierig.»
Jazz vs. Streaming
Ein Publikum, das dir die physischen Verkäufe oben hält, wird natürlich zum Problem im Streaming. Große ACT-Artists und international bekannte Künstler wie Nils Landgren und Michael Wollny haben eine niedrige sechsstellige Anzahl an Monthly Listenern bei Spotify, bei kleineren Artists des Labels sind es oft nur 10.000 bis 20.000 monatliche Hörer*innen. Zahlen, die im Pop (und anderswo) kein Business Case wären. ACT steht dabei nur exemplarisch für nahezu alle Jazz-Labels. Wie schaut die Firma auf die eigentlich ja wichtigste Erlösquelle der kompletten Branche?
«Wir waren nicht in allen Bereichen immer innovativ. Ganz im Gegenteil. Wir waren bei Streaming sehr zurückhaltend. Wir hatten ganz lange noch ein Windowing – wir haben die Releases immer erst ein paar Monate nach der physischen Veröffentlichung im Streaming freigegeben. Das Modell schien uns mit Blick auf die Vergütung der einzelnen Kreativen ungerecht, was ja bis heute diskutiert wird. Wir haben erst recht spät akzeptiert, dass wir uns in diesem Bereich öffnen und passende Strategien entwickeln müssen. Wir vergleichen uns dabei nicht mit anderen Genres, sondern eher mit dem direkten Umfeld, also: Was schaffen andere Jazz-/World-/Klassik-Artists in dem Bereich und sehen dann, dass wir oftmals gut abschneiden. Klar, die Musik ist erst mal per se keine, die der Algorithmus mag oder fördert. Das ist besondere Musik, die nur ein bestimmtes Publikum anspricht. Wir betrachten es deswegen auch als Erfolg, wenn wir es schaffen, einen Act von 1.000 auf 50.000 Monthly Listener zu bringen. Wir haben eine ganze Reihe von Acts im 100.000er- bis 400.000er-Bereich und unser Streaming-stärkstes Album hat gerade die 30-Mio.-Marke erreicht – alles positive Signale in einer Nische, die nur gut ein Prozent des Musikmarkts ausmacht. Generell gilt: Für die komplette Einschätzung über den Erfolg eines Projektes ist Spotify nur ein Teil des Bildes, Publishing, LPs, CDs und Live-Einnahmen sind meist viel wichtiger.»
Schaue ich in die USA oder nach UK, sehe ich wie junge Protagonist*innen und Kollektive es schaffen, Jazz cool zu machen, zugänglich für eine junge Generation. Oftmals sind es People of Color, die es schaffen, mit ihrer Musik und den Geschichten Begeisterung zu entfachen, oftmals gibt es Brücken zu anderen Genres wie Hip-Hop oder Elektronische Musik. Und auf einmal füllen auf einem Jazz-Konzert hunderte oder tausende junge Menschen den Raum. In Deutschland scheint das nie so richtig geklappt zu haben. Hier ist Jazz weiterhin sehr weiß, alt und männlich.
«Ich gehöre nicht zu denen, die das alte Publikum bashen. Die sind ja wahnsinnig wichtig und alt ist man ja bereits mit 40 aufwärts und die Menschen gehen hoffentlich noch viele Jahre auf Konzerte. Aber klar: Es ist eine vollkommen berechtigte Frage, warum junge Jazz-Musiker*innen – das gilt für klassische Musik ebenso – es nicht schaffen, für ihre eigene Generation Musik zu machen, sondern Konzerte für ein 40 Jahre älteres Publikum spielen. In Los Angeles und London haben es einzelne Akteur*innen geschafft, ein Momentum und eine Szene aufzubauen und das auch gut und lange zu vermarkten. Das war authentisch, sie haben relevante Geschichten erzählt und es geschafft, dass es auf einmal Jugendkultur war und nicht mehr der ‹alte Jazz›. Im Live-Bereich gibt es auch hier Konzepte, die es schaffen, etwas von diesem frischen Momentum zu generieren, zum Beispiel X-Jazz und einige andere. Aber im Streaming, auf den Socials oder als echte Artist-Marken funktioniert das hier in Deutschland selten.»
Woran liegt das?
«Der Zugang zu den Institutionen ist sicherlich ein großer Teil des Problems. Jazz oder Klassik hierzulande studieren, heißt oftmals weiterhin: gutbürgerliches Elternhaus, Instrumentalunterricht schon als Kind. Und so kommen dann gefühlt 80 Prozent der deutschen Jazz-Szene aus privilegierten (weißen) Haushalten. Und auch die Zugangsbarrieren zu Konzerthäusern, Festivals und Clubs sind oft hoch. Viele Kids, die in einer anderen Lebensrealität aufwachsen, kommen eigentlich nie mit Jazz in Berührung und können dann natürlich auch nichts mit der Musik und den Geschichten anfangen bzw. ihre eigenen Geschichten in dieser musikalischen Welt erzählen. Mein Eindruck ist, dass diese Probleme inzwischen vielerorts gesehen werden. Aber es braucht starke Anstrengungen und Zeit, damit die guten Intentionen zur Veränderung in der Realität ankommen.»
Was man von ACT lernen kann? Wenn ein Label eine echte Dachmarke sein soll, inklusive eigenem Publikum, unabhängig vom einzelnen Release, dann muss man die Marke auch zeigen, pflegen und ins Licht stellen. Es braucht Stringenz auf sehr vielen Ebenen, und hat man diese Stringenz, wird sie sich langfristig auszahlen.
Ebenso wichtig: gedankliche Flexibilität beim Geschäftsmodell. Ohne die Entwicklung der Live-Agentur als Stand-alone-Label hätte ACT vermutlich bereits die Türen geschlossen, mindestens aber das Team und damit den Wirkungsgrad reduzieren müssen. Und damit eher früher oder später an Relevanz verloren.
Oder um es mit Andreas Brandis zu sagen: machen, nicht jammern.
Musikbusiness neu denken. Diesen und viele weitere Texte findest du in den Low Budget High Spirit Magazinen.
-
Das Magazin - Ausgabe 2025
Normaler Preis €10,00 EURNormaler PreisGrundpreis pro -
Das Magazin - Ausgabe 2024
Normaler Preis €10,00 EURNormaler PreisGrundpreis pro -
Das Magazin - Bundle 2025 & 2024
Normaler Preis €17,00 EURNormaler PreisGrundpreis pro -
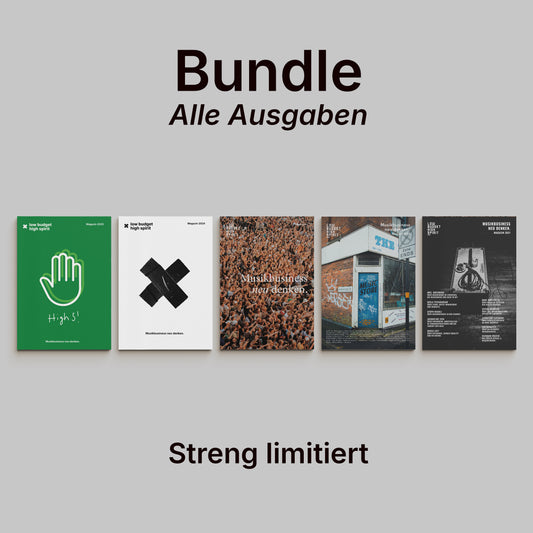 Ausverkauft
AusverkauftDas Magazin - Bundle Alle Ausgaben
Normaler Preis €35,00 EURNormaler PreisGrundpreis pro